Zur Oper am 9. Juli 1978 in München
Opernwelt, Nr. 8/1978
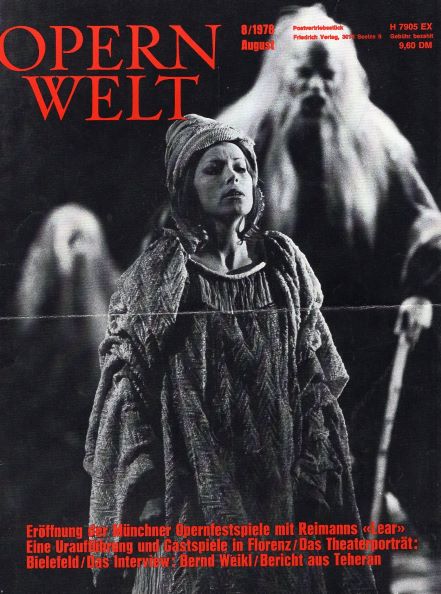


Der Spiegel, Nr. 28/1978, 10. Juli 1978
Nummern zu groß
In München stand mit "Lear" wieder mal eine Literatur-Oper zur Uraufführung an - Begleitmusik für das gekürzte Shakespeare-Drama.
Als Hausherr der Hamburgischen Staatsoper hatte August Everding einen Eid geleistet: Niemals werde er, wie sein Vorgänger Rolf Liebermann, "bei zeitgenössischen Tonsetzern Opern bestellen, nur um diesen mit viel publizistischem Tamtam die Premiere bereiten zu können".
Kaum hatte er seinen Vertrag als Intendant der Bayerischen Staatsoper unterzeichnet, brach Everding den Schwur: "Ohne feste Bestellung", das war ihm inzwischen klargeworden, setze sich "heute doch kein Komponist mehr an die Arbeit".
Der erste, der von Everdings "ehrlich eingestandenem" Sinneswandel profitierte, war der Berliner Komponist und Hamburger Professor für das Lied des 20. Jahrhunderts Aribert Reimann, 42. "Obwohl es in München immer noch schwer und gefährlich ist, eine Uraufführung anzusetzen", beschloß Everding, die diesjährigen "Münchener Opernfestspiele" am vergangenen Sonntag mit der musikdramatischen Novität "Lear", Reimanns dritter Oper, zu eröffnen.
Ursprünglich hatte der gemäßigte Neutöner sein Stück um den Shakespeare-König dem 300-Jahre-Jubiläum der Hamburger Oper zugedacht. "Aber Everding", erinnert sich Reimann, "nahm die Idee mit nach München", und das dortige Opernhaus, Modernem sonst recht verschlossen, sicherte sich die Premiere durch einen Auftrag vor dem Zugriff der Konkurrenten in Wien und Berlin, die laut Everding "auch schwer dahinterher waren".
Um Lear, dieser klassischen Figur des Sprechtheaters, bei Münchens Wohlklangsbürgern eine wirkungsvolle Premiere bereiten zu können, inszenierte Everding viel publizistisches Tamtam: In einem neuartigen Medienverbund - bei Sonderkursen der örtlichen Volkshochschulen, einer sonntäglichen Diskussionsmatinee mit Publikum, einschlägigen Kino-Programmen und einem Aufklärungsgespräch im Bayerischen Rundfunk - drehte sich alles um den sagenhaften Theater-König und die Gründe, warum er bislang dem erfolgreichen Zugriff der Opernkomponisten entgangen war.
Der deutsche Romantiker Conradin Kreutzer hatte mit einem nach der Lear-Tochter Cordelia benannten Monodram wenig Resonanz gefunden. Ein Italiener namens Frazzi scheiterte 1939 mit seinem "Re Lear". Doch auch daß Giuseppe Verdi, der bedeutendste und erfolgreichste Shakespeare-Vertoner, nach ein paar (später von ihm vernichteten) Versuchen die Finger von Lear gelassen hatte, konnte Reimann nicht abschrecken: "Lear für unkomponierbar zu halten, nur weil Verdi nicht dranging, ist barer Unsinn." Im Gegenteil: Für Reimann war gerade diese Tragödie "schon immer das einzige Shakespeare-Stück gewesen, das Ansätze fürs Musiktheater bot".
Vor zehn Jahren allerdings war auch dem bei Boris Blacher geschulten Abkömmling einer schlesischen Musikerfamilie der "erste Gedanke" an "das grandiose Thema noch zwei Nummern zu groß" erschienen.
Doch nachdem er Texte von Günter Graß, Ingeborg Bachmann und Strindberg (in seinem Opern-Erstling "Traumspiel") vertont hatte, wähnte er sich literarisch sattelfest. Den Ausschlag gab schließlich der Tip eines prominenten Zunft-Kollegen: Dietrich Fischer-Dieskau, den Reimann 1958 kennengelernt hatte und seitdem häufig, auch mit eigenen Werken, am Klavier begleitet, machte dem Musiker Mut zur großen Oper.
Vom Vertrauen des berühmten Baritons getragen, richtete Reimann alsbald "irgendwo in meinem Kopf eine Art Ablage für Lear-Gedanken" ein. Und 1976, als er endlich die ersten Noten für das Münchener Auftragswerk zu Papier brachte, war er ganz erstaunt, "wieviel Lear-Musik sich in den Jahren in mir aufgespeichert" hatte.
Gleichzeitig entdeckte der Komponist im Libretto, in dem das Original auf ein Viertel gekürzt ist, "ungeheuer aktuelle Bezüge". Der König Lear beispielsweise werde "in ganz modernem Sinne seiner Persönlichkeit beraubt", und sein machtgieriger Clan "voll Infamie, Gemeinheit und Hetze" trage "fast terroristische Züge".
Um diese "Brutalität allen Lebens" in Töne umzusetzen, kündigte Reimann ein krasses Kontrastprogramm zu dem "melodisch-verhaltenen Grundton" seiner beiden Opern-Vorläufer an: Musik "voll Schärfe und Härte".
Zu hören ist davon allerdings zuwenig. Zwar läßt Reimann in den rein orchestralen "Zwischenspielen" und ein paar hochdramatischen Passagen sein spätromantisch-üppig besetztes Orchester voll aufspielen - zum "großen Klang", "starr und schwarz". Aber auf weite Strecken degradiert er es zum bescheidenen Begleitapparat für die virtuos gestalteten Gesangspartien (in der Titelrolle: Fischer-Dieskau), zum zerbröselnden Background.
Nie, versicherte der Komponist, wollte er "ein Moment des Äußerlichen einfließen" lassen, statt dessen sollte "riesiger Raumklang" entstehen, "Reaktion des Kosmos". Doch trotz 48fach gespleißtem Streicherklang, 20stimmigen Bläserakkorden und dem diffizilen Gemisch von Halb- und Vierteltönen wirkt die kunstvoll gefertigte Partitur des 150-Minuten-Stücks vorwiegend getüftelt.
Der allzeit vollbeschäftigte Regisseur Jean-Pierre Ponnelle, im zeitgenössischen Musiktheater nur wenig bewandert, inszenierte den "Lear" wie fürs Burgtheater. Dort mag der blinde König auch besser aufgehoben sein.
Autor unbekannt
___________________________________
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 11. Juli 1978
Der verwirrte König auf der Opernbühne
Uraufführung von Aribert Reimanns "Lear" in München
Shakespeares Tragödie der Trostlosigkeit ist bald nach seinem Tode in England mit einem glücklichen Schluß versehen worden. Des Schrecklichen Ende, das Lear in Abwandlung eines Rilke-Wortes nicht mehr ertrage, wurde berichtigt. Der alte König Lear sah noch die jüngste Tochter Cordelia mit Graf Glosters Sohn Edgar den britannischen Thron besteigen. Die Untaten der älteren Prinzessinnen Goneril und Regan sowie des Glosters Bastard Edmund waren gesühnt.
Giuseppe Verdi, sonst unerschrocken vor Schreckensdramen, rang fünfzehn Jahre lang mit dem Lear-Stoff und machte um die "Luisa-Miller"-Zeit mit Antonio Sommar daraus ein Libretto. Dem jungen Pietro Mascagni bekannte er, Lears Szene auf der Heide habe ihn gehindert, es zu vertonen. Er meinte das Sturmbild, wenn der König, von allen außer Kent und dem Narren verlassen, Winde und Donner beschwört, die Natur zu vernichten.
Es steht als dritte Szene im ersten Teil der Oper "Lear", die Aribert Reimann als Auftragsgeschenk der Bayerischen Staatsoper komponiert hat. Claus H. Henneberg kompilierte den Text aus der Graf Baudissinschen Übersetzung. Einige Bilder und Nebenfiguren, wie der Herzog von Burgund, fielen weg: der Narr erscheint früher als bei Shakespeare. Die Grausamkeit der Tochter Regan wird über das Original hinaus gesteigert, wenn sie selbst dem wehrlosen Gloster ein Auge ausdrückt.
Es gehörte Wagemut dazu, einen Stoff zu veropern, dessen Entsetzlichkeit jeden Lichtblick ausschließt, der keine Liebeshandlung enthält und noch die Versöhnung im Zeichen des Todes statthaben läßt. Reimann, Jahrgang 1936, ist als Opernkomponist über Strindbergs " Traumspiel" und Yvan Gons "Melusine" zu Shakespeare gekommen. Die Idee, "King Lear" zu vertonen, ging von dem Mann aus, der als Liedersänger mit Reimann seit Jahren auf dem Podium verbunden ist und nun bei der Münchner Uraufführung die Titelpartie gesungen hat: Dietrich Fischer-Dieskau.
Zwei Teile, neunzig Minuten der erste, eine Stunde der zweite, werden in Szenen und Zwischenspiele gegliedert. Von den 12 Hauptrollen ist die des Narren gesprochen. Vier Baritone, drei Tenöre und ein Counter-Tenor stehen drei Sopranen gegenüber. Lears und Graf Glosters Gefolge binden ein Chorensemble, das im zweiten Zwischenspiel dominiert.
Reimanns Tonsprache ist nun - anders als in seinen früheren Opern - gänzlich den vokalen Mitteln und Möglichkeiten untergeordnet, die er technisch, musikalisch und dynamisch an ihre Grenzen treibt. Da gibt es psalmodische, rezitierende und deklamierende Strecken wie Lears Ansprache, wenn er zu Beginn Abdankung und Reichsteilung verkündet. Ein unbegleitetes, oft wiederholtes Fis läßt gleichsam Musik aus einem Minimum wachsen. Dann mischen sich Streicher ein, Bläser antworten. Extrem zusammengepreßte Akkorde, Cluster genannt, wirken auf das Ohr wie Bestandteile einer neuen Harmonik. Begriffe wie Konsonanz oder Dissonanz, noch gültig für neue Musik bis Messiaen und Ligeti, sind nicht mehr anwendbar. Reimanns "Akkorde" weiten sich zu eng geknüpften Geweben von zwanzig, dreißig und mehr Tönen, die einer neuen Homophonie dienen. In diesem Sinne ist "Lear" ein homophones Werk, das nur kurze Strecken von Mehrstimmigkeit enthält: gesungene Ensembles vom Duett bis zum Oktett und Chor, Zwischenspiele für Streichquartett, Bläsergruppen und vielfarbiges Schlagwerk.
An Lears Stimme zeigt sich die Vielfalt der eingesetzten Vokalmittel. Von der Psalmodie wächst ihr Ambitus zu den großen Intervallsprüngen, die Schönberg und seine Nachfolger aus Mozartschen Modellen übernommen haben. Septimen und Nonen auf und ab, kleine Melismen für Stellen dramatischer Hochspannung, am Ende vor Cordelias Leichnam zur Raketen- und Gleitmelodik aufgepeitscht, das ist der Stil, durch den alles möglich wird, woran Verdi zweifelte.
Während Gloster, Kent und der Bastard Edmund durch ähnliche Singstile charakterisiert werden, zeigt Glosters älterer Sohn Edgar ganz andere Mittel. Sein hoher, bis zum Fis reichender Tenor folgt einer Ästhetik der Oszillogramme. Zu den besten Nummern des Werkes gehört das zweite Zwischenspiel mit der folgenden Szene des gespielten Wahnsinns. Über einem Solo der Baßflöte hebt sich turmhoch Edgars Stimme, zuerst in textlosen Melismen, dann mit Septimen und Nonen Verzweiflung herausschreiend.
An diese Ausdruckswelt grenzt die der Töchter. Bei den fatalen "love tests", wenn Lear die drei um das Maß ihrer Liebe zu ihm befragt, hat Goneril ihre große, verlogene Bravourarie, der Regan ein noch brillanteres Feuerwerk der Beteuerungen folgen läßt. Von beiden hebt sich Cordelias zur Lüge unfähige Stimme einsilbig und sachlich konstatierend ab, um erst viel später zu eindringlicher Dramatik vorzudringen.
Erstaunlich ist, wie Reimann mit diesen zumindest in der Kombination neuen Mitteln die düstere, trostlose Aura des Lear-Stoffes beschwört. Man wird Zeuge einer Geburt, die eine neue, musikdramatische Sprache zur Welt bringt. Nicht nur in diesem Sinne wirkte die Uraufführung als ein künstlerisches Ereignis. Auch, wenn im ersten Teil bisweilen die Häufung der Flächenklänge und geräuschnahen Clusters das Ohr ermüdet, blieb doch die Faszination durch ein Werk von unverwechselbarer Eigenart.
Zum zweiten Mal muß Dietrich Fischer-Dieskaus Name genannt werden. Um ihn, um die Leistung dieses außerordentlichen Sängers, Musikers und Schauspielers, bewegte sich der Abend fast ohne Unterbrechung. Allein physisch ist das Maß dieser Gestaltung gigantisch. Was die schöne Bariton-Stimme dynamisch hergibt, vom nahezu geflüsterten Pianissimo bis zu den vulkanischen Ausbrüchen des Jähzorns und Hasses, wird hörbarer Ausdruck der schauspielerischen Vollendung. Wenn er die tote Cordelia heranträgt und verzweifelt über ihr zusammenbricht, scheint die Welt unterzugehen.
Die andere, an Quantität kleinere Leistung, die völlig aus dem Rahmen der Konvention heraustritt, ist David Knutsons Gestaltung des Edgar. Da klingen Töne von einer erregenden Schönheit, die zwischen den Geschlechtern zu blühen scheint. Wenn er den geblendeten Gloster, seinen nichtsahnenden Vater, führt, dann spürt man die ganze Tragik der Handlung, die Shakespeare dem Lear-Stoff beigeordnet hat.
Von den ungleichen Töchtern hat die älteste, Goneril, durch Helga Derneschs dramatischen Sopran die edelste Stimme, Regan durch Colette Lorands großartig gesungene und gelachte Hysterie den packendsten Ausdruck,. Cordelia durch die eminente Geschmackskultur Julia Varadys die rührendste Verkörperung gefunden. Gesanglich wie darstellerisch verdienen alle drei unbeschränktes Lob.
Richard Holm ist in der schwierigen Verwandlungsrolle des Grafen Kent so vorzüglich wie Hans Günter Nöcker als getäuschter Gloster. Als Edmund zeigte Werner Götz tenorale Kraft und darstellerische Wendigkeit. Die Herzöge von Albany und Cornwall waren mit Hans Wilbrink und Georg Paskuda so trefflich besetzt wie der König von Frankreich mit Karl Helm.
Über die Figur des Narren haben sich bis zu Georgio Strehler viele Shakespeare-Kenner ihre Gedanken gemacht. Sie stammt aus alter englischer Tradition. Reimann hebt sie als Sprechrolle weitgehend aus den musikalischen Zusammenhängen; vielleicht will er damit ihre dramaturgische Abseitigkeit unterstreichen. Rolf Boysen gab ihren Paradoxien eine Stimme von nicht immer überzeugender Zweideutigkeit.
Als Inszenator zeigte Jean-Pierre Ponelle eine Bühne, die weit über den Felsen und Gestrüppen der einheitlichen Dekoration einen aus geometrischem Gestänge und Scheinwerfern gefügten Himmel trägt. Durch Hebung und Senkung sowie gelegentlich schräge Hochstellung der beiden Seiten wird der Bühnenboden allen Situationen bis zum Aufruhr der Elemente gefügig. Strehlers Vorschlag, statt der Paläste und anderer Innenräume bewegliche Stege über die Heide zu ziehen, ist von Ponelle aufgenommen und virtuos verwirklicht worden. Das Gewitter ist als Inszenierung meisterlich. Auch sonst wird das Bild, werden die Szenen und Gruppierungen im Laufe des Abends immer treffender. Es ist eine der besten Opernaufführungen, an die ich mich erinnere, auch in manchen Rätseln, die sie dem Betrachter aufgibt, wie dem anachronistischen Zeichen des Kreuzes, das der Heide Gloster schlägt.
Gerd Albrecht ist am Pult die musikalische Seele des Abends. Wie er die Klangflächen des Orchesters zu farbigen Tönen bringt, die Glissandos großer Akkorde präzis macht, das ist so eine erstaunliche Leistung wie die Koordinierung der neuen instrumentalen Klangwelt mit den Stimmen auf der Bühne. Seine Fähigkeit, dramatisch zu musizieren, reicht von der Tradition der Ensembles, des Oktetts im ersten Teil, des Männerchor-Zwischenspiels und der Streit- und Mordszenen bis zu der zarten Kammermusik kleiner Streichersätze oder auch der von Baßflöte begleiteten Edgar-Szene.
Im verwickelten Apparat des mit mittlerer Stärke besetzten Orchesters nebst großer Schlagwerkgruppe alles zu erfassen, fällt auch dem geschulten Ohr nach Generalprobe und Premiere nicht leicht. Doch war der Eindruck durchweg überzeugend, der Klang des Bayerischen Staatsorchesters und des Chors der Staatsoper stets klar und auch in den vierteltönigen Kombinationen deutlich.
Für die technische Gesamtleitung ist Helmut Großer zu rühmen. Die Kostüme hat Pet Halmen mit ungewöhnlicher Phantasie, interessanten und immer überzeugenden Merkmalen nationaler und historischer Züge und leicht praktikablem Schnitt herrlich ausgestattet.
Schon nach dem ersten Teil war der Erfolg durch starken Beifall bestätigt. Zum Schluß gab es wahre Ovationen für Fischer-Dieskau, die Sänger, den Dirigenten Albrecht und den Inszenator Ponelle. Auch Reimann und sein Librettist Henneberg konnten für Zustimmung mehrmals danken. Münchens Opernfestspiele 1978 mochten sich keinen eindringlicheren Anfang wünschen als diese Uraufführung. Das Werk und seine Wiedergabe gehören zu den Großtaten des modernen Singtheaters.
H. H. Stuckenschmidt
Die Welt, 11. Juli 1978
Opern-Uraufführung in München: "Lear" von Aribert Reimann
Die Gier der bösen Töchter
Man glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu können: Schon vor der Pause donnerte der Beifall einhellig und stark. Und dabei blieb es auch nach Schluß der Vorstellung. Aribert Reimanns "Lear", uraufgeführt zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele im Nationaltheater, erspielte sich den eindrucksvollsten Erfolg, den sich eine Oper dieses Kalibers seit vielen Jahren erkämpft hat. Einer der eindringlichsten Abende des zeitgenössischen Musiktheaters gewann der Neuen Musik eine Schlacht.
Denn keinen Takt lang hatte Reimann musikalisch dem Publikum nach dem Munde geredet. Im Gegenteil: Er nahm es hart in den Griff. Bei aller musikalischen Brutalität sprach er immer deutlich zur Sache: Ein Komponist der musikalischen Wahrheitsliebe, des Mitgefühls für die Figuren seiner Oper. Gerade das gibt Reimmanns "Lear" seine ungewöhnliche Kraft.
Das Riesenhafte der dramatischen Vorlage, von Claus H. Henneberg geschickt zum Libretto eingedampft, ohne ihr die innere Dimension des Kolossalen zu beschränken, wird durch die Kostüme Pet Halmens aber gleichzeitig Bild. Lears mächtige, spitzige Krone, aus der die Gier Zacken bricht, gleicht beinahe aufs Haar der herumzipfelnden des Narren: Herrscher, sie beide, aus gleichem irrsinnigem Stamm. Die Gier der bösen Töchter bringt Halmen immer wieder grell zur Anschauung. Seine Kostüme gleichen geradezu stoffgewordenen Menschen mit all ihren Lastern und Lüsten. Dies zu Beginn gleich ein großer Wurf.
Er kann nur ins Ziel treffen dank Reimmanns musikalischer Energie. Denn das ist schließlich das überraschende dieses "Lear": Reimann stellt sich mit ihm vor auf einer ganz neuen Entwicklungsstufe. Mit "Traumspiel" (1963 - nach Strindberg) und "Melusine" (1973 - nach Ivan Goll) hatte Reimmann längst seine außerordentliche Sensibilität bewiesen, einen feinen musikalischen Spürsinn, dem stets etwas jünglingshaft Empfindsames eignete. Mit "Lear" tritt Reimann jedoch kraftvoll aus aller kunstreich-geschmackvollen, auf Winzigkeiten reagierenden Kontemplativdramatik hervor, die stets nur feinausgehörte musikalische Echos warf. Er erweist sich mit harter Hand plötzlich als Mann musikalischer Aktivität, der den Fortgang des Dramas unerbittlich diktiert.
Reimann fährt Klangflächen aus, die das Drama wie auf Podien hochhebeln und wieder absenken: eine Terrassendynamik der Cluster sozusagen. Sie bilden den musikalischen Kothurn, auf dem Reimanns "Lear" sich bewegt. Über diese gleißenden Klangflächen hin bewegen sich nun die singenden Stimmen mit außerordentlicher Charakterschärfe, einem Ausdrucksreichtum von oft schaurig anmutender Intensität.
Reimanns musikalische Phantasie wird von der Vorlage Shakespeares deutlich gefordert und findet ihre immer wieder schneidende Antwort. Allein schon wie die beiden bösen Schwestern gezeichnet werden, kennt keinen Vergleich auf dem modernen Musiktheater - und es ist natürlich Reimanns Glück, daß er in Helga Dernesch als Goneril und in Colette Lorant als Regan zwei Sängerinnen und Darstellerinnen von geradezu wüster Eindringlichkeit fand. Sie formen das Männerstück "König Lear" um zu einem der Frauen. Wie überrumpelt von dieser Attacke, finden sich die Männer erst später zu immer stärkerer Gegenwehr.
Sie wird angeführt vom schmalsten Sänger der Aufführung: David Knutson als Edgar, der im gespielten Wahnsinn seinem Counter-Tenor geradezu mondsüchtige Töne abgewinnt, einer Weltverlorenheit von gespenstischer Ausdruckskraft. Aber auch Werner Götz stemmt als Edmund seinen Tenor kräftig gegen die Übermacht der Soprane. Hans-Günter Nöcker ist ein tragisch umflorter Gloster, Richard Holm setzt sich klar durch als der brave Kent.
Der Aufführung beinahe entrückt, sie überschwebend, bekrönend: Dietrich Fischer-Dieskaus Lear. Er hat Reimanns Oper inspiriert, ihm ist sie gewidmet - und selbst in der bedeutenden Laufbahn des Sängers nimmt sie einen Sonderrang ein.
Cordelia ist Julia Varady - aber obwohl ihr die Autoren sogar eine bei Shakespeare fehlende Solo-Szene hinzuerfunden haben, fehlt der Rolle das Gewicht, sie im Zentrum des Stückes zu halten. Auch ist ausgerechnet Lears anhaltender Zwiegesang mit der sanften Tochter kurz vor ihrer beider Gefangennahme das schwächste Glied in Reimanns starker musikalischer Kette. Ausgerechnet hier, auf dem lyrischen Gipfelpunkt, mangelt es vorübergehend an Inspiration. Die Szene wäre vielleicht neu zu schreiben oder zu revidieren.
Daß es dennoch keinen Abschwung der Faszination gibt, liegt an Jean-Pierre Ponnelle, dem Regisseur und Bühnenbildner, wie an Gerd Albrecht, dem Dirigenten. Beide liefern Hand in Hand eine Aufführung, für die sich Reimann von Herzen bedanken kann. Sie besitzt Klarheit, Zielstrebigkeit und Wucht, wie sie selten einer neuen Oper zuteil werden. Ihnen ist zu danken für den unangefochtenen Publikumserfolg eines bittergewichtigen Stücks der Moderne.
Klaus Geitel
Die Zeit, 14. Juli 1978
Wahnsinn ist überall
Die Oper ist tot - sagten, bis vor kurzem, die einen, die Oper ist lebendiger denn je in unserem Jahrhundert - sagt heute sogar die Avantgarde. Ein neuer Versuch, Oper nach Literatur zu schreiben, hatte jetzt Premiere. Im Münchner Nationaltheater wurde zur Eröffnung der Festspiele 1978 Aribert Reimanns Oper "Lear" nach Shakespeare mit großem Erfolg uraufgeführt.
Ein biblischer Prophet in einer Szene von Beckett, dazu ein paar Versatzstücke aus einer nordischen Heldensage und einiges aus dem Science-fiction-Fundus: Durch eine Ödnis, wie sie trister kaum auf dem Mond zu finden wäre, durch staubig graue Felsbrocken und staubig graues Hartgras stolpert ein staubig grauer Mensch scheinbar einen Hügel hinauf, verharrt dort einen Moment, scheint sich zu besinnen, wirft dann die Arme gegen den Himmel, "Blast, Winde! Sprengt die Backen! Wütet! Blast!", steigert sich hektisch, exaltiert, überschlägt sich - ein Mann in Ekstase, ein Mensch zwischen Vision und Wahnsinn.
Das hatte sich akustisch vorbereitet. Da wird im Orchester ein weitgespannter Klang hörbar, 48 Streicher schichten alle 24 verfügbaren Vierteltöne, über sieben Oktaven auseinandergezogen, zu einer starren Tonwand; der Klang wird langsam intensiver, lauter, härter, fast beißend in seiner Schärfe; die Klangwand beginnt zu zittern, einzelne Tongruppen brechen heraus, schieben sich vor, weichen zurück, es scheint, als kreisten die Gruppen um ein imaginäres Zentrum; hinzu kommen nach und nach eine Lärmorgie aus dem Schlagwerk und, wie Blitz und Donner dazwischenfahrend, dumpf-rabiate Tontrauben tiefer Bläser und kreischende Flötenfiguren. Schließlich gerät auch die Bühne in Bewegung. Die graue Steppe fängt an zu wanken, hebt und senkt sich; ein scheinbar wirres Gefüge horizontal gespannter Stäbe fährt herab und zum Teil wieder hinauf, die Stäbe verschieben sich gegeneinander, auch sie scheinen zu kreisen, die Beleuchtung tut ein übriges hinzu - die Bühnenelemente sind entfesselt: Sturm auf der Heide, zentrale Szene in "Lear", hier in der Opernfassung von Aribert Reimann, uraufgeführt zum Beginn der diesjährigen Münchner Opernfestspiele. Das Stück könnte Operngeschichte machen.
*
Uraufführungen waren selten geworden auf der Opernbühne. Seit Rolf Liebermann Hamburg verließ, hat kein Intendant auch nur eine gemäßigte Bereitschaft zum Risiko gezeigt: keine Aufträge - keine Chance für Komponisten. Dazu die Einschätzung der Gattung durch die Autoren als scheinbar suspekt: Oper - igittigitt. Also: Nichts Aufregendes in den Programmen. Inzwischen schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Alle haben sie ein Manuskript auf dem Komponiertisch, auch wenn die Produkte manchmal noch schamhaft etwas unkenntlich gemacht sind - "Musiktheater" klingt avancierter. Zwischen den heiter-ironisch-sarkastischen Aphorismen von Mauricio Kagel und der Menschlichkeits-Utopie von Hans Werner Henze ("Wir erreichen den Fluß"), der surreal-vergnüglichen Phantasiefülle von György Ligeti ("Le Grand Macabre") und der politischen Oratoriums-Revue von Luigi Nono ("Al gran sole"), den formalen Kammerspiel-Exerzitien von Heinz Holliger ("Kommen und gehen") und der mystisch aufgewerteten Neuen Einfachheit in den szenischen Konzerten von Karlheinz Stockhausen bis zu John Cage hat sich Aribert Reimann gewissermaßen auf die tradierte und unumstößlich dominierende Position des logisch aufgebauten Struktur-Stücks, des ausdrucksintensiven Personendramas und der aussagekräftigen Literatur-Oper festgelegt. Nach "Wozzeck" und "Lulu" von Alban Berg und Zimmermanns "Soldaten" liegt mit Reimanns "Lear" ein neues starkes Werk dieser Gattung vor.
*
Aribert Reimann. Affinität nicht nur zur Musik schlechthin, sondern vor allem zur Vokalmusik durch das Elternhaus: Der Vater, Leiter des Berliner Staats- und Domchores, bringt Bach nahe, Kantaten, Passionen, Orgelmusik; die Mutter, Sängerin und Dozentin an der Hochschule, das Lied, Schubert und Hugo Wolf. Der Zehnjährige singt 1946 Weills "Ja-Sager" und komponiert Nikolaus Lenaus "Herbstklage" für Sopran und Klavier; der Vierzehnjährige beginnt ernsthafte Klavierstudien und muß die Schüler der Mutter begleiten; der Neunzehnjährige lernt Kontrapunkt bei Pepping und hat seine erste öffentliche Uraufführung; der Zwanzigjährige kommt zu Boris Blacher und will, an sich zweifelnd, Dichter werden - an ein paar Takten einer Violinsonate erkennt Blacher den zukünftigen Stil seines Schülers.
Der macht von da an seinen Weg, stetig, aber stets ohne Aufsehen zu erregen. Jedes Jahr einige Stücke autonomer Musik, Sonaten, Konzerte, Kammermusik, Orchesterwerke, Ballette. Aber jedes Jahr auch stets eine Handvoll und mehr Lieder, mit Klavier, mit Chor, mit Orchester. 1963/65 ein erster Griff zu der vokalen Großform: In Kiel wird sein "Traumspiel", Oper nach Strindberg, uraufgeführt. Schon damals: hochexpressive Linien für die Sänger, komplizierte Klangverschachtelungen durch raffiniertes Verschränken von Orchesterblöcken, intellektuell gesteuerte Ordnungssysteme auf Zwölftonbasis und rhythmischen Reihenstrukturen. 1969/71 "Melusine", Oper nach Yvan Goll in Schwetzingen; 1971 ein Celan-Zyklus für Dietrich Fischer-Dieskau, 1973 "Wolkenloses Christfest", ein Requiem. 1962 Musikpreis "Junge Generation" in Berlin; 1965 Schumann-Preis in Düsseldorf, 1963 Villa-Massimo-Aufenthalt, 1975 Lehrauftrag für moderne Liedinterpretation in Hamburg. Und neben der Komposition ständige Konzert-Tourneen als Liedbegleiter, mit Fischer-Dieskau und der Sopranistin Catherine Gayer vor allem. "Musik ist Empfindung", sagt Aribert Reimann, heute zweiundvierzig Jahre alt, "Musikmachen heißt für mich: offen sein."
*
Nun also: "Lear". Claus H. Henneberg, der schon das Libretto für "Melusine" gearbeitet hatte, benutzte für seine Einrichtung die Übersetzung von Johann Joachim Eschenburg (1777), weil die ihm "härter, klarer und theatralischer" als etwa Schlegel-Tieck erschien. Härte, Klarheit und Sicherheit in der theatralischen Funktion - damit sind auch die wesentlichen Kriterien von Reimanns "Lear"-Musik genannt.
Härte: Es sei, sagt Aribert Reimann, eines seiner größten Probleme gewesen, diese Brutalität des "Lear" musikalisch zu formulieren, ohne dabei nur äußerlich, plakativ, vordergründig zu sein. In der Tat: Bislang waren an Reimanns Musik eher ihre Sensibilität, ihre leicht verletzbaren, wie dünnes Glas zerbrechlichen Materialien, ihre zarten Farben und eine fast impressionistische Distanz aufgefallen. Der Celan-Zyklus wie das "Wolkenlose Christfest" waren dann Studien, ja ein Vorstoß zu jenen dunklen Farben und eruptiven Klangformationen gewesen, die heute im "Lear" die Härte markieren.
Diese Härte gibt es jetzt reichlich. Immer wieder setzt Reimann diese Tonmassierungen ein, als kurze, akkordartige Schläge, die den Gesang wie ein Rezitativ gliedern und stützen, als langgezogene Klangbänder aber auch, die, durch ihre Viertel-, Halb-, Dreiviertel-, Ganz- und Eineinviertel-Ton-Abstände sehr stark "geräusch-haltig", eine Atmosphäre von "Bedrohung" schaffen, von Aggressivität und, umgekehrt,. Angst.
Diese Blöcke stehen nur selten alternierend nebeneinander. Reimann schichtet die Klangplatten vielmehr unregelmäßig, schiebt sie ineinander und übereinander. Auf diese Weise wird jene Heterogenität einer Gesellschaft deutlich, und die Isoliertheit, mit der alle am Stück beteiligten Personen aus einer Egozentrik sondergleichen aneinander vorbeireden.
Klarheit: Relativ schnell offenbaren sich die "Umfelder" der Personen. Die weiten, starren Intervallsprünge etwa, in denen die eiskalte Lear-Tochter Goneril sich für gewöhnlich äußert (und die Helga Dernesch mit faszinierender Sicherheit trifft). Die Hysterie in den kurzen Vorschlägen und gleitenden Koloraturen, die fast immer aufwärts schießenden, hektisch unterbrochenen und sich beinahe selbst überschlagenden Figuren, mit denen Goneril von ihrer Schwester Regan übertrumpft werden soll (das scheint präzis für die Stimme von Colette Lorand geschrieben zu sein).
Die Dominanz auch von auf- und absteigenden Linien, die das An- und Abschwellen von aggressiven Emotionen begleiten; die vieltönigen Akkorde, die eine Art Leitfunktion haben; das Streichquartett, das den Narren begleitet und in seiner Einfachheit einen Gegenpol bildet zum Egozentrik-Lärm; die langgezogenen Polyphonien, in denen die Musik die Reflexionen des Textdichters ersetzt; die Oktaven, deren "reiner Klang" so etwas wie Todessehnsucht signalisieren; eine fast an Mahler erinnernde Ausdruckskraft, die die Schlußszene, Lears Abschied von der toten Tochter Cordelia, begleitet.
Weiter die "Transposition", mit der die Partie des Edgar, wenn der sich mit der Rolle des irren "armen Tom" tarnt, um eine Oktave in die Bereiche eines "unmännlichen" Contratenors gehoben wird (was David Knutson exzellent gelingt). Oder das beinahe liturgisch Objektive eines tonus rectus, eines aufs äußerste verknappten Gesanges auf einem Ton, der immer dann eingesetzt wird, wenn fast protokollartig etwas Wichtiges zu erzählen ist, und wozu die Reflexion im begleitenden Orchester gegeben wird. Gerade diese Vermeldungsparaphrasen erhalten gelegentlich an nahöstliche Praxis erinnernde Verzierungen, Tonumspielungen im Halb- und Vierteltonbereich, die dem ganzen eine exotische oder antikisierende Distanz verleihen.
Aber das eigentliche Raffinement in der Partitur, die geniale Umsetzung von Personenbeziehungen oder Situationsbedeutungen, von dramaturgischer Entwicklung und momentaner Singularität tut sich erst dem Auge und dem analytischen, will sagen: rechnerischen Intellekt auf.
Die innere Beziehung etwa zwischen der jüngsten Lear-Tochter Cordelia, die, vom Vater in seiner Macht- und Autoritätshybris enterbt und verflucht, den selber in Elend und Wahnsinn Gestürzten zu retten sucht, und Edgar, dem legitim-getreuen Sohn des Grafen Gloster, der den um sein Augenlicht und damit um sein Ich gebrachten Vater aufzurichten sucht.
Cordelia und Edgar besitzen als musikalische Identität je eine Zwölftonreihe mit doppelter Eigenschaft: Innerhalb beider Reihen ist jeweils der "Krebs" gleich der "Umkehrung", untereinander sind sie über Kreuz austauschbar - Edgars erste Halbreihe ist gleich Cordelias zweiter und umgekehrt. Nicht genug damit: zwölftönige Streicherkomplexe aus diesem Reihenmaterial bilden die Grundlage für die reflektierenden Passagen, mit denen der Narr das Grauen kommentiert. So wird musikalisch die Interpretation des Geschehens in die Strukturen hineingesponnen.
Oder die Sturm-Sphäre. Was sich da als zweimal vierundzwanzigtöniger Akkord aufbaut, wird im weiteren Verlauf der Komposition immer wieder zitiert, etwa wie wenn aus einer großen Säule unterschiedliche Teile herausgebrochen und zu anderen plastischen Gebilden zusammengesetzt oder an anderer Stelle eingepaßt würden: Der Wahnsinn ist überall.
Wenn dann zum Schluß der ursprünglich über sieben Oktaven sich spannende Klang auf vier Oktaven zusammengedrückt wird, wenn diese Blöcke durch eine rhythmische Reihe moduliert werden, wenn schließlich eine aufsteigende Linie - Cordelias Reihe - sich über das Ganze legt, hat das Visionäre der Sturmszene sich in Realität gewandelt, hat Lear umgekehrt all seine Hybris abgelegt, empfindet er zum erstenmal Mitleid, weiß er, was "die Welt vom grausen Fluch erlöst".
Schließlich aber darf Reimanns "Lear"-Musik als eine überdimensionale Metamorphose gesehen werden. Gewiß sind auch hier, nach dem Vorbild des spätromantischen Musikdramas, die Versatzstücke eingepaßt: Jeder hat sein Umfeld, seine Struktur, seinen Klang, seine Instrumentierung, sein Material. Aber nichts erscheint in der schon einmal erlebten Form. Man erkennt das Frühere, aber man registriert auch - zugegebenermaßen wohl nur mit Hilfe des Notenbildes - die Änderung.
Aber wie schon Alban Berg der Ansicht war, daß die der "Wozzeck"-Musik zugrundeliegenden Strukturen dem Hörer durchaus unbewußt bleiben dürfen, so besitzt auch Aribert Reimanns "Lear" vor aller intellektuellen Binnenordnung die nötige Spontaneität der Ausdruckskraft, sowohl in seiner Härte wie in den gewiß nicht wenigen lyrischen Passagen. Cordelia (die ausgezeichnete Julia Varady) etwa hat, wenn sie ihren Vater wiedergefunden hat, eine der schönsten "Arien" zu singen, die in der neueren Musik geschrieben wurden, und Lears Schlußmonolog ist bei allen Unterschieden von ähnlich überirdischem Glanz, so entrückt, wie etwa Wotans "Abschied" oder Isoldes "Liebestod". Dies ist gewiß Dietrich Fischer-Dieskau zu danken, der im Lear wieder eine seiner ganz großen Rollen besitzt - eine Rolle, die, umgekehrt, ganz auf ihn und sein lyrisches wie dramatisches Ausdrucksvermögen hin geschrieben wurde.
*
Was endlich die Aufführung im Münchner Nationaltheater betrifft: Gerd Albrecht, ein Dirigent, der schon so oft, vor allem auch durch seine Gesprächskonzerte, bei Publikum und Musikern Verständnis für die Neue Musik hat schaffen können, hat das Orchester der Bayerischen Staatsoper, dem ja immer noch anhängt, einmal einen Aufstand gegen Pendereckis Spielvorschriften probiert zu haben, offenbar von der Qualität des "Lear" überzeugen, hat Intensität wecken können und - soweit überhaupt kontrollierbar - Präzision, vor allem aber Engagement, beim Orchester, beim Chor und beim ganzen Solisten-Ensemble.
Jean-Pierre Ponnelle setzt Reimanns Übermaß-Tragödie in ein geradezu karges Ambiente, bleibt in einem einzigen Bild, eben der staubig grauen Heide, in einem ansonsten leeren Bühnenraum, hält sich eher an den Endspiel-Charakter des Stückes, spielt nur ganz selten mit der Technik, mehr dafür, und zwar in symbolträchtiger Weise, mit dem Licht. Daß er am Ende in dem ganzen Bühnenturm helles blauhaltiges Licht aufziehen läßt, mit "Lohengrin"-Anklängen oder zumindest optimistischen Assoziationen von "neuem Anfang" winkt, erscheint die einzige Unlogik in seiner ansonsten eindrucksvollen Inszenierung eines in vieler Hinsicht außergewöhnlichen Stückes.
Heinz Josef Herbort
___________________________________
Süddeutsche Zeitung, 11. Juli 1978
Münchner Opernfestspiele
Mehr Tragödie als Narrenspiel
Aribert Reimanns "Lear" erlebte am Nationaltheater in Ponnelles Inszenierung seine Uraufführung
Lear: Nennst du mich Narr, Junge?
Narr: All deine Titel hast du weggeschenkt, mit diesem bist du geboren.
*
Achtzehnmal hat der 40jährige Giuseppe Verdi seinem "Lear"-Librettisten, dem venezianischen Advokaten Antonio Somma, brieflich Verbesserungsvorschläge gemacht, ehe er einsah, daß die Sache nicht zu realisieren war. Die Notwendigkeit, "einen so maßlosen Stoff in kleinere Portionen zu bringen, dabei aber doch die Originalität und Größe der Charaktere und des Dramas zu wahren" - davor schreckte Verdi schließlich zurück. Aber dem shakespeareschen "fool", dem Narren, huldigte er doch am Ende seines Lebens, im "Falstaff"-Finale: "tutto il mondo è burla" - die Welt ist ein Narrenhaus.
Wer den "Lear" vertont (und mancher, darunter Beethoven, hätte es gern getan), darf der Frage nach seinem Shakespeare-Verständnis nicht ausweichen. Was hat es zu bedeuten, wenn Aribert Reimann und Claus H. Henneberg, der Librettist dieser "Oper in zwei Teilen nach William Shakespeare", den anfangs zitierten Dialog zwischen Lear und seinem Narren ersatzlos streichen? Und es fällt auf, daß bei ihnen der Narr zwar gelegentlich seinen sarkastischen Senf dazugibt, aber dennoch seiner für Shakespeare wesentlichen Funktion entkleidet wird: nämlich Lears Gesprächspartner, Spiegelbild, in letzter Instanz sogar Lears Double, Lears geheime Identität zu sein. Zwar steht er im ersten Teil der Oper fast pausenlos auf der Bühne, aber doch mehr als leere Staffage denn als dramaturgische Schlüsselfigur. Und so fehlt dem abgehalfterten, von seinen blutrünstigen Töchtern malträtierten, tragisch umnachteten Lear jene eben aus der Konfrontation mit dem Narren stammende Dimension, die für den heutigen Zuschauer die aktuellste sein dürfte, fehlt die Dimension des Absurden, die das schier grenzenlose Unheilspathos ins Groteske umbiegt. Und die surrealistische Sprache, die vulgären Metaphern des Narren - fast alles verschenkt, gestrichen. Und damit auch die Bezüge zu Beckett.
Verklärter Shakespeare
Das wie immer reich betextete und bebilderte Münchner Programmheft reagiert darauf, indem es etwa statt Jan Kott ("König Lear oder das Endspiel") dem Goethe-Zeitgenossen Johann Joachim Eschenburg umfänglich das Wort erteilt, weil Reimanns Librettist sich auf dessen frühe Lear-Übersetzung stützt. Wieso Reimann dann aber seiner Oper als Motto Eichendorff voranstellt, wonach Lear nur deshalb wahnsinnig werde, weil ihm der "trostlose Heidenglaube" das christliche Jenseits verweigere, will mir überhaupt nicht einleuchten. Verklärt, mildert Musik den grausamen Pessimismus Shakespeares am Ende nicht genug? Die langgezogene und von einer leisen Musik so eindringlich wie nur in der alten Oper ausstaffierte Sterbeszene Lear-Cordelia spricht jedenfalls für sich selber.
Freilich hat die Oper ihre eigene Gesetzmäßigkeit. Sie muß raffen, verdichten, emotional vertiefen, in Klang- und Schaubilder umsetzen, in melodische Linien auflösen, was im Schauspiel als begrifflicher Sinn und sprachliche Poesie sich entfaltet. "Musik ist sprachähnlich", sagt Adorno, "aber Musik ist nicht Sprache. Ihre Sprachähnlichkeit weist den Weg ins Innere, doch auch ins Vage."
Ein Sänger war es, Dietrich Fischer-Dieskau, der dem 1936 geborenen Aribert Reimann Mut machte, die "Lear"-Oper zu schreiben. Reimann, Blacher-Schüler, Einzelgänger, glänzender Könner, bringt Voraussetzungen für eine solche Arbeit mit, er schrieb die Oper "Melusine", vertonte Strindberg und Celan, Hölderlin und Eichendorff, Shelley und Pavese, ehe er sich seit 1973 mit seinem Requiem "Wolkenloses Christfest", den Orchestervariationen, den Gesängen von Sylvia Plath auf Lears Spuren, auf die "Wege zu Lear" begab. Unmöglich, die geradezu abenteuerlich kunstvoll gebaute Partitur des Werkes zu entschlüsseln, ihre Formen und Strukturen, ihre melodischen und klanglichen Erfindungen, Entsprechungen zu Charakteren, in Kürze abzuschildern.
Bannende Töne
"Der stehende Akkord beginnt von unten herauf langsam zu vibrieren, wie ein Erdbeben", so versucht Reimann selbst in Tagebuchnotizen die musikalische Konstellation zu fassen. Zweieinhalb Stunden lang wird der Hörer aus dem Orchestergraben heraus gebannt: mit Tontrauben aller Intensitätsgrade, Vierteltonreibungen, minutenlang stehenden und sich drehenden Klangflächen, Blechballungen von monströser Härte, verwirrenden rhythmischen Verschiebungen, lyrischem Innehalten solistischer Stimmen. Gerd Albrecht und das bewundernswerte Staatsorchester gebieten diesem Tönekosmos mit nicht nachlassender Energie.
Diese Klangmittel werden zur scharfen Charakterisierung - von Figuren, Ausdruckshaltungen, Situationen - eingesetzt, nie als bloße Materialdemonstration. Cordelia und Edgar, die "Guten", sind mit einer zwölftönigen Reihe und deren Permutation, sind lyrisch ausgewiesen. Was David Knutson da an Koloraturbeweglichkeit, Falsett-Virtuosität vollbringt, läßt staunen; und Julia Varady bezwingt mit der mädchenhaften Innigkeit stimmlicher und szenischer Gestaltung. Der Narr ist als Sprechrolle angelegt, die Rolf Boysen mit krächzender Klangfarbe bewältigt, stets begleitet von irisierenden Streichquartettkomplexen.
Goneril und Regan, Lears böse Töchter, haben riesige Intervallschritte, brutales Stimmvolumen zu demonstrieren: die eine in weiten Bögen, die andere in hysterisch gezackten Figuren, was Helga Dernesch und Colette Lorand bravourös in Bühnenwirklichkeit verwandeln. Weitere Rollen sind ideal besetzt: der Jago-Zwilling Edmund mit Werner Götz, die beiden Herzöge mit Hans Wilbrink und Georg Paskuda, Gloster und Frankreich mit Hans Günter Nöcker und Karl Helm, Kent mit Richard Holm.
Dietrich Fischer-Dieskau, bei seinem Auftritt mit weißem Gott-Vater-Rauschebart zunächst eher irritierend, hat sich den Lear sehnlichst gewünscht. Er bietet eine große und seine Mittel nicht schonende Gesangsleistung, beschwört da eine jederzeit fesselnde, in rabiaten Ausbrüchen furchterregende, im finalen Schmerz Anteilnahme fordernde Operngestalt, die sich lange einprägt. Die große Heideszene, aus mehreren Heide-Bildern Shakespeares zusammengefaßt, und die Sterbeszene geraten zum Höhepunkt. Auch ein Bild wie den Übergang zur 4. Szene im zweiten Teil vergißt man nicht leicht: während der Narr sich in langgezogenem Decrescendo in den Schatten verkriecht, fährt die vordere Bühnenlandschaft hoch, beginnt sich der nackte Edgar weit hinten mit echohaften Vokalisen zu regen. "Heide: Ein Nocturno jenseits der Welt" (Reimann).
Überhaupt die Szene! Jean-Pierre Ponnelle, für Inszenierung und Bühnenbild verantwortlich, hat den Stoff bildlich in einen einzigen Griff genommen. Graue, unwirtliche Heidelandschaft mit abweisenden Steinquadern bedecken eine Bühne, die unruhig-beweglich ist, sich an den Seiten anhebt - hier hat keiner festen Boden unter den Füßen. Und der Raum, die Welt, in der die Tragödie angesiedelt ist, bleibt finster. Ponnelle hat die Bühne ganz geöffnet, hat keinerlei Kulissenillusionen aufgebaut, und so gähnt aus dem schwarzen Bühnenbauch die technische Unter- und Überwelt der Beleuchterbrücken und Scheinwerfertürme, und das Vorhänge- und Kulissengestänge ersetzt Gewitterwolken und Wind.
Absurdes Theater
Das ist faszinierend ausgedacht und technisch perfekt bewältigt. Farben - vorwiegend schreiendes Rot - tragen nur die jeweils Herrschenden an sich: zunächst Lear und sein Narr, später die geilen Todestöchter. Der Rest der Welt ist in wesenloses Grau gehüllt. Auch die Kostüme (Pet Halmen) gehorchen somit Reimanns der Tragödie verpflichtetem Lear-Konzept: "Die Isolation des Menschen in totaler Einsamkeit, der Brutalität und Fragwürdigkeit allen Lebens ausgesetzt". Ponnelle sind dafür eindringliche Figurengruppierungen, Menschenskulpturen eingefallen, auch von Menschen gezogene Linien: immer wieder irren Gloster und Lear, Edgar und Edmund, simultan zum Geschehen im Vordergrund, ziellos in der weiten Bühnenlandschaft umher. Die Groteske, die das Libretto mit der Entfunktionalisierung des Narren leugnet, wird durch die Szene wieder hereingeholt. "Die Natur hat uns vergessen." "Es gibt keine Natur mehr" - dieser Dialog Becketts könnte hier stattfinden.
Verschwindend gering ist der Anteil der zeitgenössischen Oper am gesamten, von Tradition, Publikumsgeschmack und Schwerfälligkeit des Betriebes beeinflußten "Opernaufkommen" der Gegenwart. Aber ohne zeitgenössische Oper würde die Gattung austrocknen, steril werden. Deshalb ist es August Everding und seinem Ensemble hoch anzurechnen, mit dem Auftragswerk "Lear" ein sichtbares Zeichen gesetzt zu haben. Aribert Reimann und Jean-Pierre Ponnelle ist aber noch etwas anderes gelungen: Sie haben nicht nur ein szenisch-musikalisch stimmiges, sich nicht heuchlerisch anbiederndes Musikdrama geschaffen, sondern auch eines, das - der überzeugte, keineswegs hysterische Applaus bewies es - beim Publikum offene Augen und Ohren findet. Freilich sind da gewisse Garantien eingebaut: die große literarische Vorlage, die große Sängerautorität, die große tragisch-individualistische Charaktergeste des Zornes, des Schmerzes, des Todes. Vielleicht hat tatsächlich die Musik unseres Jahrhunderts es erst möglich gemacht, die komplexe, tiefe Parabel vom König, von der Kreatur Lear in der Oper zu erzählen. Aber die Sprache des Narren und seine Dialektik ist ihre Sprache nicht.
Wolfgang Schreiber
___________________________________
Münchner Merkur, 11. Juli 1978
Glanzvolle Eröffnung der Münchner Festspiele mit Reimanns neuer Oper "Lear"
Fischer-Dieskaus großartiger Wahnsinn
Ein Riesenerfolg zum Auftakt der Opernfestspiele: die Uraufführung einer "Lear"-Oper nach Shakespeares Drama, komponiert im Auftrag der Bayerischen Staatsoper vom renommiertesten deutschen Opernkomponisten der jüngeren Generation, Aribert Reimann, dazu eine hochkarätig kühne Inszenierung, Starsänger, ungezählte "Vorhänge", ein ganz großer Erfolg.
Lear als Opernheld? Unbedingt. Shakespeare führt uns in diesem dunkelsten Stück aus seiner "dunklen Epoche" in eine fast mystische Welt, die Natur spielt gleichnishaft mit, die Menschen werden von geradezu archaischen Emotionen und Instinkten getrieben; und Psychologie ist auf urtümliche Grundsituationen zurückgedrängt. Die Figuren sind überlebensgroß, bisweilen auch primitiv und kindlich, reduziert auf eine einzige Eigenschaft.
Keiner gibt nach
Edgar ist stets nobel, Regan stets grausam, Kent immer loyal. Keiner gibt, und sei es auch nur aus Schlauheit, nach. Sie prallen aufeinander, bis sie, einer nach dem andern, zugrunde gehen. Der einzige, der sich aus dieser Starrheit befreit, und dies nur, nachdem er in den Irrsinn gleichsam wie in einen Heilschlaf geflüchtet ist, ist Lear selber.
Shakespeare setzt sich also über alle Normen hinweg, scheint demonstrieren zu wollen, daß es ihn reizte, hier einmal einen Stoff zu gestalten, in dem Fühlen und Leiden so übermächtig sind, daß sie sich einer plump direkten Sprache widersetzen und nur noch mit großzügig lapidaren Mitteln ausgedrückt werden können. Genau hier aber ist der Punkt, wo Musik einspringen und mit ihrer übers Detail hinauswachsenden Ausdruckskraft die Gefühle in der Tiefe ausloten kann. Reimanns Wahl des Stückes war also richtig. Shakespeares Lear ist kein Held, keine heroische Figur, sondern wie Ödipus ein halb archaischer, halb moderner Typus, ein von Existenzangst Gequälter - nicht umsonst wurde er mit Kafkas Gregor Samsa, mit Becketts Clov und Hamm verglichen.
Ist Reimanns Musik nun modern? Für den Durchschnittshörer zweifellos - seiner Dissonanzen wegen. Aber dissonantische Musik solcher Art haben wir seit mehr als sechzig Jahren. Und heute gibt es bereits eine jüngere Generation, die ungeniert wieder mit wohltönenden Akkorden arbeitet, den "schon" 42jährigen Reimann bereits als alt empfindet.
Seien wir also vorsichtig mit Schlagworten, die alles versimpeln. Reimann beherrscht virtuos den Orchesterapparat. Er kann ihm an Farbe, Charakteristik und Atmosphäre entlocken, was immer er will. Da gibt es die raffiniertesten Mischungen - ein wahres Kompendium einer exzellenten Orchesterkunde. Das führt von "Wozzeck"-Nachfolge, erschreckenden Instrumenten-Kombinationen, Glissandoeffekten und Kollagen normal gespielter mit um einen Viertelton tiefer gestimmter Akkorde bis zu schneidenden und brutalen klanglichen Geräuschkombinationen. Als Klangkulisse zu Shakespeare ist das alles von einem ernormen Könner virtuos gemacht. Aber ist sie nicht doch mehr? Sie hüllt Shakespeares Wort nicht nur in eine narkotische Atmosphäre, sondern sie schafft eine präverbale Bedeutungsfülle, deutet an, was dem Wort oft noch nicht greifbar, was noch unterhalb eines mit Worten überhaupt faßbaren Ausdrucks liegt.
Die Aufführung besitzt über weite Strecken hinweg eine sich unmittelbar mitteilende Kraft und eine bildhaft starke Wirkung wie seit langem keine. Jean-Pierre Ponnelle, Inszenator und Bühnenbildner in einer Person, läßt in einer Shakespeareschen Einheitsszenerie spielen, die zugleich Palast, Heide, Innenraum oder Feldlager ist - dies raffiniert durch Kleinigkeiten wie pflanzliches Grün, welligen Boden, einen Stuhl oder sonst ein Requisit angedeutet. Dazu treten als Verfremdungs-Objekte, die zugleich auch den Nebenklang des Heute einströmen lassen, Beleuchtungstürme an den Seiten und der als ein Hauptakteur mitspielende Schnürboden. Ein Gewirr von Zügen, die sich wild verfransen und förmlich zu bekämpfen scheinen, rotiert dann als ein bösartiger Unheilstifter knapp über der Szene - ein gespenstischer Anblick.
Wenn die Spannung gegen Schluß vielleicht etwas abflaut, liegt es nicht an einem Abgleiten der Inszenatoren, sondern daran, daß die steilen Steigerungen des Geschehens den Zuschauer so hoch geputscht haben, daß er (wie öfters bei Shakespeare) fast gleichgültig auf die allzu zahlreichen Toten der letzten Szenen reagiert.
Vielfältig schillernd gibt Fischer-Dieskau den Lear, hier Shakespeares einzige Person, die eine Wandlung durchmacht. Begierig und mit vor selbstzufriedener Eitelkeit gespreizten Fingern hört er sich die Lobhudeleien Gonerils und Regans an, reagiert auf Kents vergeblichen Appell trotzig wie ein Kind und stampft greisenhaft schwerfällig davon. Wenn ihn dabei der Narr bei der Hand nimmt, hat man fast den Eindruck, er sei der gespielte und Lear der eigentliche Narr. Auf dem Höhepunkt seines Wahnsinns trippelt er mit dem Gebaren eines Kleinkindes auf die Bühne und äußert sich in einem exaltierten Jargon von Sprech- und Fistelstimme, singt dann wieder kraftvoll und ausdrucksreich, ist immer präsent.
Hysterie-Anfall
Selbst Cordelia gibt sich zunächst fast rüde, ist bockig wie ihr Vater auch. Julia Varady spielt das zuerst in aller Mürrischkeit aus. Dann verliert Shakespeare die Figur während langer Akte aus den Augen und läßt sie, geläutert wie ihr Vater, erst zum Schluß in lichter Reinheit als Repräsentantin des Guten und Lieblichen wiedererscheinen. Hier gibt sich die Varady vollendet lyrisch in ihrer sanften Verhaltenheit und ihren kunstvoll geführten Sopranbögen.
Die Rolle der Regan ist ihrem böse hysterischen Wesen entsprechend gespickt mit Koloraturen und ganz auf einen affektiert künstlichen Stil ausgerichtet. Colette Lorand gibt sie scharf akzentuiert bis in die Horrorszene der Blendung des Gloster hinein. In der Erkenntnis, sich außerhalb alles Menschlichen zu bewegen, flüchtet sie schließlich in einen grauenerregenden Hysterie-Anfall. Böse auch, dabei strahlend schön singend, die Goneril Helga Derneschs.
Narr Boysen
Eine Figur, die des Narren, ist auch in dieser so intelligenten Aufführung nicht so selbstverständlich integriert wie alle anderen. Dabei stört nicht mal die Tatsache, daß er als einziger nicht singt, sondern der Umstand, daß dies nicht konsequent durchgeführt ist. Auch für sein Sprechen sind bestimmte Tonhöhen vorgezeichnet, die ein stilisiertes, musikalisches Sprechen herausfordern. Durch solche Einengungen gingen ihm trotz des engagierten Einsatzes von Rolf Boysen etwas das Leichte, Wendige, scheinbar Improvisierte seiner Einwürfe verloren.
Richard Hom ist der tapfer aufbrausende Kent, Hans Günter Nöcker der schnell erregte und etwas törichte Gloster, Werner Götz ein infamer Edmund. Ein musikalischer Geniestreich Reimanns, den der Librettist Henneberg allerdings nicht aufgreift, ist, daß Reimann Edmund die Tonfolge f, g, a, h, ein Tritonus-Intervall also, anstimmen läßt, den sogenannten Diabolus in der Musik. Schließlich noch der ungewöhnliche Fall einer Rolle für Kontratenor, Edgar, den David Knutson mit sanften, ausschließlich in weiblichen Stimmregionen verlaufenden Bögen singt.
Was der Dirigent Gerd Albrecht jetzt zeigt, ist gewissermaßen nur die Spitze eines Eisbergs, das Resultat einer langwierigen Probenarbeit - sie die mühselige Voraussetzung, daß er nun ganz souverän und scheinbar locker die Sänger und Instrumentalisten und den trefflichen Chor über alle technischen Untiefen hinwegführt.
Helmut Schmidt-Garre
___________________________________
Abendzeitung, München, 11. Juli 1978
Die Wahnsinnigen tasten sich durchs dürre Gras
Nationaltheater: Donnernder Applaus für die Uraufführung von Reimanns "Lear"
Donnernder Applaus für eine Uraufführung - mit dieser Überraschung begannen die Opernfestspiele 1978. Premiere hatte ein Auftragswerk der Bayerischen Staatsoper, Aribert Reimanns "Lear". Den Shakespeare-Text hat Claus H. Henneberg eingerichtet. Gerd Albrecht dirigierte, von Jean-Pierre Ponnelle stammen Bühnenbild und Inszenierung, von Pet Halmen die Kostüme und von Josef Beischer die Choreinstudierung. Im Zentrum der Oper und des Erfolges: Dietrich Fischer-Dieskau als Lear.
Donnernder Applaus also für etwas, was man gemeinhin als ärgerlich empfindet - eine neue Oper. Hört man genauer hin, so ist so neu nicht, was Reimann in München vorführte. Eine Oper, die viel von dem wiederholt, was den Erfolg dieser Gattung ausmacht: banal gesagt - menschliche Leidenschaften mitreißend erzählen, kommentieren.
Das haben Verdi, Puccini und mit anderen Mitteln auch Berg verstanden. Sich an Shakespeare festzuhalten, besitzt ebenso Tradition, zumal dessen Dramen die Axt der Librettisten gut vertragen, vor allem, wenn so virtuos damit umgegangen wird, wie von Claus H. Henneberg.
Reimann verlangt also kein elementares Umdenken. Für ihn darf Theater sein, was es immer schon war. Vom "Hinterfragen" der bewährten Mittel hält er nichts, vom Nachdenken über eine neue Ästhetik ebensowenig, formale Erkundungsgänge überläßt er anderen, das Risiko ebenso. Ich will dem Komponisten nicht am Zeug flicken, nur - "Lear" hätte so auch vor einem halben Jahrhundert geschrieben werden können. Reimanns Oper ist von der Anlage her ein Oldtimer. Applausgeeignet.
Was sie bemerkenswert macht, ist die Musik, ist Reimanns Kraft als Komponist, zur abgelagerten Dramaturgie eine akustische Sprache zu finden, deren Intensität man sich schwer entziehen kann. Reimann arbeitet weitgehend in Klangflächen von hoher Raffinesse, mit Streicherteppichen von changierendem Glanz, der aber nie ins Luxuriöse abgleitet. Er hebt die Stimmen merkbar ab, gibt den Rollen charakteristische Eigenheiten mit, baut diffuse Räume, die immer wieder von Viertel- und Halbton-Dissonanzen durchschnitten werden.
So entstehen aufregende Turbulenzen, breit angelegte Höhepunkte, entsteht Lärm, dessen vorgebliche Brutalität nichts Gewalttätiges hat, sondern aus einer Vervielfachung der lyrischen Grundkomponente des Komponisten besteht. Das ist original und bringt Reize, auf die man weitgehend gespannt und aufmerksam reagiert.
Die traditionelle Grundhaltung allein garantiert aber noch keinen Erfolg. Die Münchner Uraufführung lebt zu einem erheblichen Teil vom Engagement und der Intensität aller Beteiligten. Das beginnt bei Gerd Albrecht, der mit viel psychologischem Geschick das Orchester zum Durchhalten bewegen und zu einer Premieren-Leistung animieren konnte, die dem Werk sehr, sehr geholfen hat.
Dreispurig durchs Drama
Dietrich Fischer-Dieskau gab dem Lear vieles, infantilen Wahnsinn, Erinnerung an einstige Herrscher-Größe, an Macht und Weisheit. Seine drei Töchter, Helga Dernesch und Colette Lorand als raffgeile Goneril und Regan, Julia Varadys glockenrein, unschuldige Cordelia, fuhren dreispurig imposant durch das Drama. Männer als posierende Chargen, glanzvoll und hohl zugleich (Hans Wilbrink, Georg Paskuda, Karl Helm) oder als die großen Leidenden, wie Hans Günter Nöckers Gloster, David Knutsons zartgliedrig denaturierter Tenor-Edgar, Werner Götz’ Edmund-Brutalität und Richard Holm, der seinen Kent mit viel Mimen-Schmerz bekleidete.
Ponnelles Personenregie machte deutlich, worum’s in diesem Stück geht, warum er aber Schauspieler Rolf Boysen als Narr zuschminken ließ, bis kaum mehr etwas von seiner Schauspieler-Potenz durchkam, bleibt ein Geheimnis.
Ponnelles äußerer Rahmen für diese Tragödie fasziniert: ein weit nach oben hin aufgerissenes Bühnenhaus, sichtbar die Scheinwerfer, sichtbar und virtuos in Szene gesetzt die Hebebühne, leere auf und ab fahrende Kulissenzüge als Symbol für Sturm und Bedrohung. Ponnelle brachte Elemente der kinetischen Kunst und ihrer seltsam aggressiven Sachlichkeit mit ins Spiel, kontrastiert durch archaisiert gewandete Figuren (Pet Halmen) und eine mit Felstrümmern übersäte Heidelandschaft.
Durch dürres Gras tasten sich Figuren des Wahnsinns, mit großer Gestik, opernhaft grotesk, gerade so als könnten sie die schreckliche Wahrheit der Shakespeare-Tragödie kaum fassen.
(Weitere Aufführungen am 13. und 17. Juli.)
Helmut Lesch
___________________________________
tz, München, 11. Juli 1978
Einhelliger Jubel - das Publikum feiert den "Lear"
Reimann-Uraufführung zur Eröffnung der Opernfestspiele
Um es gleich zu sagen: Der Schuß der "Lear"-Einführungsmatinee ging nach hinten los. Diese schädigende Abschreckungsreklame - man mußte ja fast annehmen, Aribert Reimanns Musik erfülle den Tatbestand der Körperverletzung - hält nun vielleicht auch Gutwillige und Neugierige fern. Zu ihrem Schaden, wie die Festspieleröffnung beweist: Ein Theaterabend ersten Ranges!
Man lernte ein Werk des Musiktheaters kennen, das mit seiner hochexpressiven Sprache über weite Strecken, zumindest im ganzen ersten Teil, dem nahezu uneinholbaren Vorwurf von Shakespeares "König Lear" gerecht wird.
Die Gefahr hätte ja nahegelegen: Hybrider zeitgenössischer Komponist spielt den Trittbrettfahrer bei der großen Lokomotive Shakespeare und bleibt doch jämmerlich hinter ihm zurück.
Aber so war’s nicht. Reimanns Mut, sich mit diesem Weltstoff einzulassen, vor dem ein Verdi zurückscheute, ist zwar abenteuerlich, aber die bei Literaturopern so häufige Verkleinerung der Vorlage findet nicht statt.
Nerven vibrieren
Das fürchtet man, wenn man sich das Libretto von Claus H. Henneberg ansieht: Was da an Verästelungen und Zwischentönen gegenüber Shakespeare fehlt, notwendig fehlen muß, erschreckt. Doch das Gerüst ist operngerecht aufgebaut, und Reimann reichert das Handlungsskelett musikalisch wieder an, umkleidet es mit dem Fleisch seiner rigoros komponierten, handwerklich blendend gemachten Musik.
Klangmassen ja, breite Klangflächen, die die Zuhörernerven vibrieren lassen - aber kein Ton, der nicht genau auf die Stücksituation bezogen wäre. Keine einzige erschlichene, undurchdachte Wirkung. Statt dessen (Theater-)Sinn für Kontraste: nach der grandiosen Wahnsinnsszene - gehäuftes Material, dann fahle Farben, Pochen im Kopf - eine von Bläsern getragene, retardierende, Spannung lösende Partie, die dem Zuhörer neue Bereiche eröffnet.
Man kann emotional reagieren auf Reimann, muß nicht mit musikwissenschaftlichem Besteck daran herumsezieren. Rein emotional erschließt sich auch die leise Schwäche des Werks.
Das ist der Schluß - der alte, sterbende Lear mit der toten Cordelia im Arm.
Hier behilft sich Reimann mit einer relativ unvariierten statischen Klang-Fläche, die das Ersterben wohl zu wörtlich nimmt. Da vermißt man die Kraft eines zwingenden musikalischen Einfalls, der der Ungeheuerlichkeit dieser Endsituation gewachsen ist.
Reimann kann über diesen Schluß selbst nicht ganz glücklich sein. Es spricht für ihn, daß er - Könner, der er ist - nicht zu irgendeiner orchestralen Übertünchung gegriffen hat. Vielleicht wächst ihm in einigen Jahren eine neue Version des Schlusses zu.
Bockiger König
Jean-Pierre Ponnelle in Hochform! Sein "Titus", sein "Pelleas", sein "Boulevard Solitude" waren und sind die Spitzenproduktionen unseres Spielplans, und dieser "Lear" ist auf der gleichen Höhe.
Über den bockig-monomanischen König und seine beiden vielleicht gar nicht nur bösen Töchter bekommt man mehr zum Nachdenken, ist näher an Shakespeare als oft in selbst sehr guten Schauspiel-Aufführungen. Strehler-Niveau!
Nackte Beleuchtungstürme grenzen eine Spielfläche ein, die mit Steinen und hartem Gras, Sumpf, Moor, Heide, eben Lears Seelenlandschaft ist. Und dieser Boden ist auf erschreckende Weise beweglich, kann sich heben und senken, zeigt bildhaft, wie Lear den Boden unter den Füßen verliert.
Die Bühne ist bis in Schnürbodenhöhe offen. Sämtliche Züge (schwarzes Metall) heben und senken sich, werden Bedrohung, Gefängnis, Material für Spiegelungen - es entsteht ein variabler Theaterraum, an dem nichts mehr Dekoration, alles nur noch Zeichen ist.
Farbe bringen die fast aggressiv ausführlichen Kostüme (Pet Halmen) - archaischer Prunk, der das Märchen im Mythischen verankert.
Mit dem Märchenkern des Stückes hängt es wohl auch zusammen, daß die Textreduzierung keine Verarmung wurde, sondern die Stationen des Dramas noch konzentrierter hervortreten.
W e n n ein Ponnelle sie mit seiner eminenten Bildphantasie erfüllt. Wer außer ihm kann so zwingend Gruppen stellen, kann eine Geste im Zeitlupentempo so ins Pathos überführen, daß sie als höhere Bühnennatur ankommt?
Und wer könnte sich ähnlich unbefangen des eigenen Vorrats an inneren Bildern bedienen, vom kindlich Sinnfälligen - die großen Beutel der bösen Töchter, in die sie wie im Kasperltheater raffen, was sie bekommen können - übers Märchenhafte bis zum alten Testament oder kunsthistorischen Vorbildern.
Oberstes Gesetz für Ponnelle ist wieder die Partitur. Dem Komponisten muß das Herz aufgehen, wenn er erlebt, wie Ponnelle das Publikum s e h e n läßt, was komponiert ist.
Die Sänger dürfen singen. Sie haben zwar extrem schwierige Partien, aber die sind für Kehlen geschrieben.
Präziser Chor
Dietrich Fischer-Dieskau macht den zugleich hoheitsvollen und störrischen Lear wahr, hat die unwiderstehliche Komponente von Kindlichkeit, die das Leben mit diesem König doch unerträglich macht. Sein Zusammenbruch, seine Trauer sind herzbewegend.
Eine spröde, starke Cordelia mit makellos schönem, ausdrucksvollem Gesang ist Julia Varady. Helga Dernesch und Colette Lorand stürzen sich vehement in die bösen Schwestern - beklemmend der hysterische Ausbruch der Lorand nach Glosters Blendung.
Bewunderung für das ganze Ensemble. Souverän Richard Holm als Kent; der "arme Tom" stellt sich mit den Konter-Tenortönen des beweglichen David Knutson in ein irrlichterndes Zwischenreich.
Der Schauspieler Rolf Boysen, als Narr wie eine Spiegelung des Königs eingeführt, hat eine veritable Gesangspartie und bewältigt sie fast wie ein Berufssänger. Mit dem totalen Stilbruch, also dem reinen Sprecher, für diese Partie hätte Reimann einen entschiedeneren Akzent setzen können.
Gerd Albrecht am Pult leistet Übermenschliches, hat die Partie im Kopf, als sei’s ein Verdi und feuert die Musiker zu höchstem Einsatz an. Applaus für den Chor, der nicht nur präzis singt, sondern im Spiel den nervtötenden randalierenden Haufen deutlich macht, den die beiden Schwestern mit Recht lästig finden.
Bessere Voraussetzungen für ein zeitgenössisches Werk sind schlechthin nicht denkbar. Es hat sich gelohnt - wann hätte ein verwöhntes, festspielgieriges Publikum eine Uraufführung je so enthusiastisch aufgenommen?
Beate Kayser
___________________________________
Frankfurter Rundschau, 11. Juli 1978
Ein irrer Rigoletto
Aribert Reimann schrieb für Fischer-Dieskau seine "Lear"-Oper
MÜNCHEN. Verdi führte seinen langgehegten Plan, Shakespeares Lear-Tragödie als Oper zu komponieren, nicht aus; außer höchstens zu Schauspielmusik oder zu einer Ouvertüre vermochte der Stoff bislang keinen bedeutenderen Komponisten zu reizen. Ein musikalisch ungenutzter Brocken der dramatischen Weltliteratur: Der Berliner Musikdramatiker Aribert Reimann (Jahrgang 1936) wurde sofort aufmerksam, als der Sänger Dietrich Fischer-Dieskau (mit dem er oft als Liedbegleiter zusammenarbeitet) den Lear-Stoff vorschlug. Seit 1968 "lagerte" sich im Kopf Reimanns potentielle Lear-Musik "an", wurden kleinere Werke Vorstudien zum schwelenden großen Thema. 1975 kam der Auftrag der Bayerischen Staatsoper für eine 1978 uraufzuführende Festoper; er wurde zum unmittelbaren Avviso für das bisher umfangreichste musikdramatische Werk Reimanns.
"Lear", jetzt bei der Eröffnung der Münchener Opernfestspiele ein einhelliger - und angesichts der notorisch konservativen Haltung des Münchener Opernpublikums ebenso erstaunlicher wie fast schon verdächtiger - Uraufführungserfolg, ist Literaturoper und Staroper zugleich. Die Besinnung auf ein bisher anscheinend "opernuntaugliches" Sujet geht mit Recht von dem Gedanken aus, daß nicht nur die allgemeine Rezeption, sondern auch die spezifische kompositorische Entwicklung "reif" werden kann für bestimmte Stoffe. Die Aktualität der Lear-Thematik zeigte sich jüngst in dem von Shakespeares Grundkonstellation ausgehenden "Lear"-Drama Edward Bonds. Eine freie dichterische "Umdeutung" lag allerdings nicht im Sinne Reimanns und seines Librettisten Claus H. Henneberg, der, auf eine wenig bekannte Übersetzung von J. J. Eschenburg (1777) zurückgreifend, das Stück im wesentlichen nur straffte.
"Staroper" wurde "Lear" dadurch, daß sie den Sänger Fischer-Dieskau und sein darstellerisch-musikalisches Gestaltungsvermögen wesentlich in ihre musikdramatische Struktur einbezog. Das ist natürlich vollkommen legitim. Freilich impliziert es auch gewisse Vorentscheidungen und Begrenzungen des dramaturgischen Konzepts.
Reimann interpretiert die Handlung, indem er sich weitgehend mit der Figur Lears zu identifizieren scheint, als "Isolation des Menschen in totaler Einsamkeit, der Brutalität und Fragwürdigkeit allen Lebens ausgesetzt". Von diesem "existentialistischen" Ansatz her kann er das paternalistische Moment bei Lear nicht dingfest machen. Lear begibt sich seiner Macht auf eine Weise, die die Menschen um ihn deformiert; er zwingt seine Töchter Goneril und Regan zur Heuchelei, und Cordelia, die sich dem entzieht, wird verstoßen. Die von Lear durch seinen weisen oder närrischen Verzicht ausgelösten Machtkämpfe ziehen auch den König, der sich von der Politik abgewendet hat, weiter in ihren katastrophalen Strudel. Am Schluß vertilgt die von Lear unfreiwillig in Gang gesetzte Vernichtungsmaschine alle Hauptbeteiligten.
Zu zeigen wäre in einer modernen Lear-Tragödie, wie menschliche Geschichte nicht naturhaft, sondern durch das von Menschen hervorgebrachte Geflecht der autoritären und abhängigen Beziehungen "unbewußt" Böses zeugt; gerade so ließe sich Shakespeare aktuell lesen. Reimann und Henneberg imaginieren sich ihre Lear-Welt aber anscheinend ziemlich ungebrochen als Kampfplatz der "Guten" und der "Bösen". So werden die machtgierigen Töchter auch musikalisch hurtig zu Monstern hergerichtet, und der "Bastard" Edmund verhält sich zu dem "legitimen" Edgar wie eine Höllenfurie zum "reinen Tor". Gegenüber Shakespeare bringt die Musik immer wieder nicht Differenzierung, sondern Verkürzung der Charaktere. Lear selbst, über dessen Leiden vergessen werden kann, daß er kraft des Königsamtes zum Motor des "Verhängnisses" wurde, erhält mehr und mehr eine Aureole, wird schließlich, an der Leiche der "guten" Tochter zu einem Über-Rigoletto, einem Denkmal der Klage und der Weltanklage, zum schmerzlich verklärten Vater - und in solcher Sentimentalisierung dürfte einiges mitschwingen von dem merkwürdigen Bann, der noch heute von "großen alten Männern" ausgeht (Churchill, Adenauer, de Gaulle), denen gern verziehen wird. So faszinierend die Idee eines menschlichen "Wachstums" durch das vom Machtverzicht hervorgerufene Leiden auch ist: als Hauptmotiv lenkt sie ab von dem Verderben, das gerade durch diesen Verzicht ausgelöst wird (und damit von der politisch aktuellsten und interessantesten "Lear-Dimension").
Die Versuchung zur Hypertrophierung der Lear-Gestalt ist sicher auch darin begründet, daß Fischer-Dieskau mit dieser Rolle noch einmal gleichsam alle Darstellungsregister ziehen wollte, eine Figur zu verkörpern trachtete, in der die geschundene Kreatur Wozzeck, die idealtypische Vatergestalt und der "Narr in Christo" gleichermaßen aufgehoben wären. Es ist zu befürchten, daß diese "Synthese" letzten Endes nun doch keine lebendige Operngestalt erzielte, sondern eine eher prekäre Kunstfigur.
Reimann hat es sich bei dieser Oper gewiß nicht leicht gemacht. Die umfangreiche Partitur (zwei Teile; drei Stunden Spieldauer) speichert die vielfältigsten Erfahrungen, die der Autor vor allem als Liederkomponist, aber auch bereits als profilierter Opernmusiker machte (Strindberg-Vertonung "Ein Traumspiel" 1963, "Melusine" 1969). Der "Vokalstil wirkt gekonnt und eigenständig, wiewohl keineswegs so "auratisch" wie der von Luigi Nono. Das bedeutet aber auch, daß Reimmanns Palette breiter und differenzierter ist. Sie umfaßt auch groteske und bizarre Idiome. Zitat- und Montagetechniken spielen bei ihm aber eine geringe Rolle. Die oft wild zerklüfteten instrumentalen ,,Felder" werden mit "gemilderten" mikropolyphonen Methoden à la Ligeti gebildet. Vor allem in den instrumentalen Zwischenspielen, die die Szenen (Simultanszenen gibt es nur rudimentär) verbinden, kommt eine beträchtliche Klangphantasie zur Geltung, ohne daß die Akkordballungen oder die signalartigen Tutti-Stöße doch die Gewaltförmigkeit der turbulentesten Passagen aus Zimmermanns "Soldaten" übertrumpfen möchten (wie es vor der Aufführung "werbewirksam" verlautete). Insgesamt handelt es sich um eine unbezweifelbar zeitgenössische, avancierte Opernmusik, die alle möglichen Anregungen der letzten Jahrzehnte verarbeitet, aber ebensowenig auf Neues hindeutet wie die durchweg herkömmliche Dramaturgie.
Daß sich diese Oper allzusehr dem normalen Musiktheaterbetrieb anschmiegen würde, ist freilich nicht zu behaupten. Der Anspruch an die Interpreten ist enorm. In München schienen gute Bedingungen für eine optimale Wiedergabe geschaffen. Jean-Pierre Ponnelle sorgte nicht nur für eine lebendige Personenregie, sondern hatte auch einen attraktiven Bühnenraum hergestellt: eine flexible Bodenfläche mit steiniger Graslandschaft, Allgegenwart der mythischen Heidestimmung. Darüber wölbte sich freilich kein Gewitterhimmel, vielmehr wurden die nüchternen Stege, Galerien und Gerüste des Bühnenhauses bis weit oben sichtbar. Die Sänger-Darsteller zeigten charakteristische Timbres: Helga Dernesch und Colette Lorand als böse Töchter, Julia Varady als seraphische Cordelia, Werner Götz als bleckend tenoraler Bösewicht Edmund, David Knutson als sein lyrisch knabenhafter Gegenspieler Edgar. Weit mehr als alle anderen hat Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie Gelegenheit zu facettenreicher Darstellung: mit visionärem Vater-Pathos, mit belkantistischer Kantabilität wie mit kirchernden und quengelnden Narrentönen kann er den Lear zu einer Glanzrolle ausbauen. Der Chor versieht in diesem Stück keine sehr großen Aufgaben; um so mehr ist das Orchester psychographisch und handlungskommentierend präsent; unter der Leitung von Gerd Albrecht spielten die bayerischen Staatsmusiker, ungeachtet einiger Unschärfen, mit gehöriger Wucht, aber auch mit gutem Klangsinn für die leisen, meist von dunklen Streichern grundierten lyrischen Episoden, die auch in dieser Partitur Reimanns einen besonders großen Stellenwert einnehmen.
Hans-Klaus Jungheinrich
Hamburger Abendblatt, 11. Juli 1978
München jubelt über Hamburgs "Jubiläums-Oper"
Aribert Reimanns "Lear" uraufgeführt
Das Ereignis, das zur 300-Jahr-Feier der Hamburgischen Staatsoper bestellt worden war, fand in München statt. Aribert Reimanns Shakespeare-Oper "Lear" von August Everding 1975 in Auftrag gegeben, wechselte mit dem Intendanten das Institut und erlebte jetzt bei ihrer Uraufführung zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele einen in der neueren Geschichte des Musiktheaters beispiellosen Triumph ohne jeglichen Protest des Publikums gegen Werk, Inszenierung, Interpreten.
Endlich einmal gilt es, nicht eine Eintagsfliege mit freundlichem Dank zu Grabe zu tragen, sondern die Geburt einer wahrhaft großen Oper zu feiern. Dabei ist dieses Werk alles andere als ein Zuckerschlecken für kulinarisch gestimmte Festspielbesucher: Der Berliner Komponist Aribert Reimann (z. Z. Gast-Professor an der Hamburger Musikhochschule) hat die Brutalität und den Wahnwitz dieser Shakespeare-Tragödie mit gewaltigen BaIlungen von Blech und Schlagzeug auch musikalisch kühn und direkt zur Sprache gebracht.
Reimann hat, sich modernster Mittel bedienend, aber dennoch die Tradition nicht verleugnend, eine große, in der Totenklage Lears um Cordelia erschütternde Trauermusik geschrieben. Der einstige Kieler Intendant Claus H. Henneberg lieferte ihm dazu ein brauchbares Libretto.
Wieder einmal erwies es sich als Vorteil daß ein Komponist nicht für irgendwen, sondern für ganz bestimmte Sänger seine Stimmen notiert hat - für Dietrich Fischer-Dieskau, der die Anregung zu dieser Oper gegeben hat, als Lear, für Helga Dernesch und Collette Lorand als böse und entsprechend primadonnenhaft hysterische, Töchter Goneril und Regan, für Julia Varady als gute und entsprechend lyrisch timbrierte Tochter Cordelia und für den Counter-Tenor David Knutson als Edgar. Dabei zeigte sich aber auch, daß die Oper ihre eigenen Gesetze hat. In dem Männerstück "Lear" dominieren auf der Opernbühne - trotz und neben der phänomenalen Leistung von Dietrich Fischer-Dieskau in der Titelpartie - die drei Frauen und der Kunst-Sopran.
Jean-Pierre Ponnelle hat ein ingenieuses Bühnenbild – eine naturalistische Heidelandschaft zwischen nackten Bühnenwänden – geschaffen und dahinein seine eindrucksvolle, vielleicht ein wenig zu abgezirkelt tableauhafte Inszenierung gestellt. Gerd Albrecht dirigierte das nur auf dem Papier furchteinflößende, den Hörer spontan packende Cluster-Werk so transparent, aber auch so emotionsgeladen, wie es sich der Komponist nur wünschen konnte.
Bernd Plagemann
Berliner Tagesspiegel, 14. Juli 1978
Lear auf der Narrenbühne
Aribert Reimanns Shakespeare-Oper bei den Münchner Festspielen uraufgeführt
Das gegenwärtige Musiktheater steht im Zeitalter Fischer-Dieskaus. Wenn Dietrich Fischer-Dieskau sich eine Oper wünscht und ein verantwortlicher Komponist fühlt sich dem vorgeschlagenen Stoff auch nur einigermaßen gewachsen, dann wird die Oper geschrieben werden. Im Fall von Aribert Reimanns "Lear" hat der schöpferische Interpret Anregung und Mut gegeben und nun das Werk, in das der Komponist über zehn Jahre Nachdenken und 1976/78 viel harte "erschöpfende" Arbeit investiert hat, an der Bayerischen Staatsoper im Kreis eines ebenbürtigen Ensembles einem unglaublichen Premierensieg zugeführt. Umgekehrt: es ist Reimanns unbestreitbares Verdienst und Zeichen seines Werdegangs, daß ihm zunächst als Liedbegleiter, dann als hiervon inspiriertem Vokalkomponisten stets die besten der Sänger zur Verfügung standen: Fischer-Dieskau, Grümmer, Haeflliger, McDaniel und viele mehr widmeten ihre Kunst den Uraufführungen des heute 42jährigen Berliner Komponisten.
Fischer-Dieskau also wollte den Lear spielen, und die Betrachtung dieser Leistung allein würde die Oper lohnen; ...aber er wußte auch, mit wessen Musik. Der sensible Komponist mit der Paul-Celan-Affinität würde der richtige sein (ein schöner Brief des Dichters an den Musiker ist in einer Foyer-Vitrine ausgestellt).
Reimanns "Lear", seine dritte Oper nach "Ein Traumspiel" und "Melusine", ist ein äußerst kunstvolles, vielschichtiges, großartiges, ungleichwertiges, ein ehrfürchtiges Werk. Ob die schwierige Partitur geeignet sein würde, die mehr festlicher Repräsentanz des Traditionellen verschriebenen Münchner Opernfestspiele zu eröffnen, war offenbar selbst innerhalb des von weißblauem Fahnenschmuck flankierten Nationaltheaters umstritten. Wenn man einem charmant-uncharmanten Interview der "Abendzeitung" glauben darf, fand der eingesessene Bayerische Generalmusikdirektor die Planung des neuen Intendanten nicht so gut. Das Premierenpublikum zeigte sich nun, überraschend sicherlich auch für die meisten Beteiligten, enthusiastisch, fast möchte man sagen: dankbar auf seiten Everdings.
Reimanns Partitur ist esoterisch und opernhaft zugleich, und ihre opernhaften Züge sind nicht die schlechtesten. Grandios die Sturmmusik, notiert auf fünfzig Notensystemen untereinander, ihr vierteltönig differenziertes, geräuschnahes und elementares Fortissimo, in das die Singstimme des - dem Unwetter in freier Natur ausgesetzten - Titelhelden mit einer Art von Fluch- oder Rachearie "Blast Winde!" einfällt. Das ist "gearbeitete" Dramatik, die ihresgleichen sucht.
Gut über die Rampe kommt auch ein "Duett" der beiden "bösen" Schwestern, Regan und Goneril, die als Figuren im Märchen ihre Vorbilder haben und sich bei Reimann in mehr oder weniger hysterisch-hochgestochener Virtuosität ergehen, während die musikalische Entwicklung der "guten" Tochter Cordelia sich von der stockenden (pausenreichen) Ausdrucksweise der Sprachlosigkeit zur Iyrischen Linie weitet. Dies geschieht übrigens in ihrer .großen Versöhnungsszene mit Lear in rhythmisch relativ freiem und daher flexiblerem Vortrag, den Reimann mehrfach verwendet und durch schwarze Notenköpfe ohne Querstriche angibt.
Sprechstimme, mitunter musikalisiert, ist dem Narren zugeteilt, aber auch zum Beispiel dem "Verstummen" (wenn Cordelia, zur rhetorischen Liebesbezeugung aufgerufen, ihr "Nichts" sagt, vergeht auch Lear im Augenblick das Singen), klischeehafter beim Verlesen eines Briefes. Daß die Gesangsstile der Personen sich durchkreuzen und von Situationen abhängen, verhindert einförmige Parallelität. Eine musikalisch aparte Rolle ist die des Edgar (des in der Simultan-Handlung ebenfalls, wie Cordelia, von seinem Vater, Gloster, verkannten liebenden Kindes); der verträumte Madrigalton des Countertenors wandelt sich in affektierte Koloratur, wenn der Verfolgte, sich verstellend, den Wahnsinnigen spielt. Zitate gibt es nicht in der Partitur, es sei denn eine B-A-C-H-Chromatik-Sphäre nach der Blendung Glosters, die für stellvertretendes Leiden stehen mag.
Obwohl Claus H. Henneberg die umfangreiche fünfaktige Shakespeare-Tragödie geschickt zum zweiteiligen Libretto gerafft hat, ist das Problem der Literaturoper, die Textmengen musikalisch aufzuarbeiten, nicht so gelöst, daß es beim Hören gänzlich in Vergessenheit geriete. Streckenweise ermüdet eine Hochexpressivität des Dialogs in Permanenz. Dafür entlohnt die Schönheit der musikalisch bedeutenden Zwischenspiele und, über das Geschilderte hinaus, nicht zuletzt die Partie des Lear, die man sich nun allerdings schwer getrennt von ihrem ersten Interpreten vorstellen kann.
Den zornigen Koloraturen antwortet die leise Verzweiflung –"Weint!" -, der Hektik des Wahnsinns, der Machtlosigkeit - "Ich bin der König selbst" - die Beruhigung des Erkennens: "Habe Geduld mit mir", und schließlich nach Cordelias Tod, der Klagemonolog über den dunklen Orchester-Clustern. Fischer-Dieskau singt das mit einer Klangpalette zwischen Grelle und herrlichster anrührender Lyrik, und der Wahnsinn, den er spielt, ist fernab vom gewöhnlichen Bühnenwahnsinn, nämlich unheimlicherweise eher so, als stelle sich im Extrem eine Möglichkeit des scheinbar Normalen dar, als könne diese hitzige Nervosität jeden von uns befallen und verändern. Fischer-Dieskaus Cardillac, vor vielen Jahren, war von verwandter Art.
Daß der "Lear" nun sogleich zum Siegeszug über die Musikbühnen ansetzen wird, ist, unwahrscheinlich, weil die Partitur sehr anspruchsvoll ist. München hat sich die Besetzung etwas kosten lassen. Helga Dernesch, Colette Lorand und Julia Varady (Cordelia) als glänzende Vertreterinnen der Frauenrollen, Rolf Boysen als Narr, Hans Günter Nöcker als Gloster, Werner Götz der metallischere, David Knutson der höhere und zartere Tenor in den Rollen seiner Söhne, dazu respektable Nebenfiguren, der Opernchor und das in diesen Tagen sehr strapazierte Bayerische Staatsorchester. Aus Überzeugung vom Werk setzte Gerd Albrecht am Pult sein Können mit ebensoviel Engagement und Erfolg ein wie die Solisten auf der Bühne.
Die Inszenierung Jean-Pierre Ponnelles in eigenem Einheits-Bühnenbild (Kostüme: Pet Halmen) neigt in ihrer Machart der Endspiel-Interpretation Jan Kotts zu. Der Konfliktentwurf ist so märchenhaft wie absurd: ein mächtiger Herrscher macht die Verteilung seines Erbes von einem Redewettbewerb abhängig. Das ist seine groteske Falle. Stellvertretend für die Ländereien wird die Königskrone, ohnehin nahe an der Narrenkappe, zerteilt. Die Landschaft - ausgedorrtes Heidegestrüpp mit weißen Steinen als auf- und abbeweglicher Boden eingebettet in den mit Galerien, Gestänge und Scheinwerfern ausgestatteten Großraum der kahlen, anti-illusionistischen Riesenbühne - ist eine des modernen Theaters. Rotierend spielen die Stangen ihre Rolle in der blitzdurchzuckten Sturmszene. Der abgehende Narr, der auf der Narrenbühne nicht mehr gebraucht wird, weil Lear in seine Rolle geglitten ist, läßt Kleid und Kappe auf der Szene zurück. Ponnelle arbeitet schlüssig mit einfachen Signalen, mit Simultan-Aktionen oder Interaktionen. Lears verschuldetes Hiobs-Schicksal verfehlt die Zuschauer (-hörer) dank Fischer-Dieskau nicht, während die Regie letztlich die Frage offen zu lassen scheint, ob hinter der Parabel eine gerechte göttliche Ordnung steht, ob das Gute, das Cordelia vertritt, fortwirkt oder untergeht mit ihrem Tod wie das Böse mit dem ihrer Schwestern. Ponnelles gutes Recht, denn Shakespeare gibt keine eindeutige Antwort, Reimann auch nicht - und so kann man das Scheinwerferlicht, das am Ende das tote Paar Lear/Cordelia gleißend bescheint, unterschiedlich deuten: als aufgehende neue Welt oder als V-Effekt.
Sybill Mahlke
Stuttgarter Zeitung, 14. Juli 1978
Aufruhr der Elemente
Münchner Uraufführung von Aribert Reimanns Lear-Oper
Verdi gab den Plan, Shakespeares "König Lear" als Oper zu komponieren, nach jahrzehntelanger Überlegungen schließlich wieder auf. Zu Mascagni, der sich mit dem gleichen Plan trug, sagte der Uralte: "Die Szene, in der König Lear sich auf offener Heide befindet, schreckt mich ab." Da bekam es auch Mascagni mit der Angst zu tun: "Er, der Riese des musikalischen Dramas war zurückgeschreckt, und ich... Ich habe im Leben nicht mehr von Lear gesprochen."
Andere waren weniger furchtsam. Von Berlioz gibt es eine Ouvertüre, von Balakirew eine ausgewachsene Schauspielmusik. Seit neuestem gibt es auch eine "König Lear"-Oper. Sie stammt von Aribert Reimann, dem zweiundvierzigjährigen Berliner Komponisten. Von Dietrich Fischer-Dieskau, der sich von Reimann oft am Klavier hat begleiten lassen, kam der Anstoß. August Everding, seinerzeit noch Intendant in Harnburg, erteilte Reimann den Kompositionsauftrag fürs Hamburger Opernjubiläum - und transferierte den Auftrag mit seiner Übersiedelung nach München. Und so eröffneten die Münchner Opernfestspiele 1978 den Reigen ihrer Veranstaltungen mit der Uraufführung von Reimanns "Lear", Oper in zwei Teilen nach William Shakespeare, eingerichtet von Claus H. Henneberg (dem Kieler Ex-Intendanten). Sie wurde ein stürmisch bejubelter, durch keinerlei Proteste getrübter Erfolg.
Für Reimann selbst bedeutet die Hundertvierzig-Minuten-Partitur einen enormen Fortschritt gegenüber seiner "Melusinen"-Oper von 1969. Dieser Stoff mit seiner ungeheuerlichen Häufung von Greueln, Gewalt, Betrug, Folter und Mord, hat Reimann entschieden über seine bisherigen Grenzen hinaus gefordert. Der Aufruhr der Elemente, die Entfesselung der Natur, ja des Kosmos ist von einer musikdramatischen Härte und Wucht, wie sie auf der Opernbühne seit Zimmermanns "Soldaten" nicht mehr gehört worden ist. Ohne sich im mindesten in illustrativer Vordergründigkeit zu verlieren, schichtet Reimmann hier Klänge auf, so kompakt wie komplex, ein einziger Aufschrei der vergewaltigten Menschlichkeit.
Lange Melodielinien
Sie stellen das eine Extrem der minuziös durchkonstruierten, gleichwohl keinem schulischen Dogma verpflichteten Partitur dar. Das andere Extrem sind die langen Melodielinien, die sich von Lears unbegleitetem Eingangsspruch bis in den Schlußgesang mit der toten Cordelia im Arm verfolgen lassen. Sie begegnen im Verlaufe der Oper immer wieder, verdichten sich zu ariosen Gebilden für Lear und die von ihm verstoßene Tochter Cordelia, werden ins Karikaturistische travestiert in der Zeichnung der beiden heimtückischen Töchter Goneril und Regan, verlagern sich bisweilen ins Orchester und erreichen ihre reinste, schlichteste und ergreifendste Ausprägung in den Vokalisen des Gloster-Sohns Edgar, wenn er zum armen Tom wird (die Partie ist für einen Kontratenor geschrieben) und in seinen ungemein anrührenden Begegnungen mit Lear und mit seinem geblendeten Vater. Hier erreicht Reimann ein melodisches Karat, das einerseits an Desdemonas Lied von der Weide und andererseits an den Klagegesang des Einfältigen in "Boris Godunow" erinnert.
Ja, dieser "Lear" ist eine musikgesättigte, richtige Oper. Mit Männerchören (Lears und Glosters Gefolge), die in der Münchner Aufführung unvermeidlich an den Auftritt der Mannen in der "Götterdämmerung" denken ließen. Und mit außerordentlich differenziert ausgehörten, musikalisch außergewöhnlich vielgestaltigen und gegensätzlichen Zwischenspielen des konventionell besetzen, lediglich im Schlagzeugapparat etwa erweiterten Orchesters. Die Sängerrollen sind strapaziös, aber dankbar und jedenfalls äußerst wirkungsvoll, selbst die der widerwärtigen Schwestern (Goneril als dramatischer, Regan als hysterischer Koloratursopran, in München bravourös von Helga Dernesch und Colette Lorand gesungen, die beide freilich unfreiwillig Aschenbrödels Stiefschwestern in Erinnerung brachten) und des abgefeimten Gloster-Bastardsohns Edmund (eine markante Charakterstudie des Tenors Werner Götz).
Ob man die Opernhaftigkeit dieses "Lear" unbedingt so betonen muß, wie es Jean-Pierre Ponnelle in der Personenführung in seiner Münchner Inszenierung tat, scheint mir sehr die Frage. Es ist eine Inszenierung, die, durchgängig in einer ebenfalls von Ponnelle entworfenen, etwas zu schicken, silberspitzigen Heide spielend, nicht mit Versenkungen und Maschinentricks spart - besonders in der großen Sturmszene, wenn die Erdoberfläche aufbricht und die Züge im nackt aufgerissen daliegenden Bühnenhaus ständig, gegeneinander verschoben, gesenkt und wieder hochgezogen werden. Indiskutabel dagegen die Kostüme von Pet Halmen, wie aus ältestem Fummel- und Maskenfundus. Hier wurde eine Luxusplunder-Ästhetik praktiziert, die einen plüschigen Rückfall in ästhetische Positionen darstellt, welche wir durch Peter Brook und Giorgio Strehler ein für allemal überwunden glaubten.
Jegliche über das funktionsdramaturgisch unbedingt Notwendige hinausgehende "Ausstattung" erscheint hier lediglich als Verdoppelung, da Reimanns Musik den Raum ohnehin völlig ausreichend akustisch möbliert und die Charaktere motiviert. Wobei nicht verschwiegen sein soll, daß Ponnelles Inszenierung Reimanns volle Zustimmung fand.
Nicht gut vorstellbar ist hingegen eine erhellendere, umsichtiger disponierte musikalische Wiedergabe als sie Gerd Albrecht - schon seit geraumer Zeit ein ausgesprochener Reimann-Spezialist - mit dem blendend aufgelegten Bayerischen Staatsorchester bot. Bestechend vor allem die Klarheit und Durchhörbarkeit ihres Musizierens, das auch in den tumultuarischsten Ausbrüchen nie der Kontrolle durch den Verstand entglitt. Der einzige andere deutsche Dirigent, dem man neben Albrecht eine ähnlich analytisch-engagierte Realisierung auf vergleichbarem Niveau zutraut, ist Michael Gielen in Frankfurt (wonach man auf die Düsseldorfer Zweiteinstudierung unter Friedemann Layer doppelt gespannt ist).
Auch besetzungsmäßig hatte München eine Idealmannschaft aufgeboten, aus der sich Julia Varadys rührend zarte, dabei fest und bestimmt singende Cordelia heraushob, aber auch David Knutsons hellstimmig ins Visionäre gesteigerter Edgar und Hans Günter Nöckers düster getönter Gloster (der sehr an Henzes General in "Wir erreichen den Fluß" erinnerte, der ja auch nach seiner Blendung plötzlich wahrheitshellsichtig wird). Mit der weinerlich-melodramatischen Anlage der Rolle des Narren konnte ich mich weniger befreunden - Rolf Boysen wirkte da eher wie ein vom Stimmbruch heimgesuchter Hoftheater-Rigoletto.
Fischer-Dieskau in der Rolle, die er sich gewünscht hat. Um seinen Lear ist von Anfang an eine furchterregend große Einsamkeit. Groß im Ton seiner Verkündigungen, bis in das nächtliche Schlußgestammel des "Weint, weint, weint...", wächst er mit seiner fürchterlichen Leidenserfahrungen zu immer größerer, immer reinerer Menschlichkeit auf: ein Mensch, geschlagen wie Hiob, mit einem Organ, dem Zärtlichkeit und flehende Bitte ebenso zu Gebote stehen wie grollende Donnerswut und rasender Zorn - "jeder Ton seines Lear, jeder Blick ging durch unser Herz", um Ludwig Tieck zu zitieren, mit seiner Eloge auf den Lear des Schauspielers Johann Friedrich Fleck.
Ohne Rücksicht auf Konventionen
An seinen Librettisten Cammarano hatte Verdi in seinen jungen Jahren, lange vor seiner Unterhaltung mit Mascagni, geschrieben: "Auf den ersten Blick gibt sich "König Lear" als ein so gewaltiges und komplexes Drama, daß es unmöglich scheint, eine Oper daraus zu machen. Doch nachdem ich es genau geprüft habe, glaube ich, daß die Schwierigkeiten, so groß sie auch sein mögen, nicht unüberwindlich sind. Wir müssen uns nur davor hüten, aus "König Lear" die übliche Art von Oper zu machen. Wir können sie in einer vollständig neuen Art behandeln, von großem Zuschnitt, ohne auf irgendwelche Konventionen Rücksicht zu nehmen..."
Die Oper völlig neuen Zuschnitts, von der Verdi Zeit seines Lebens träumte (noch mit Boito diskutierte er über die Möglichkeit eines "Re Lear") ist Reimanns "Lear" sicher nicht. Eine Bereicherung unserer musikalisch etwas ausgetrockneten zeitgenössischen Musiktheaterszene stellt er gleichwohl dar. Auch wenn er nicht ganz die ungeheuerliche kathartische Wirkung erreicht, die uns von den Schauspielinszenierungen Brooks und Strehlers im Gedächtnis verblieben ist.
Horst Koegler
Stuttgarter Nachrichten, 14. Juli 1978
Zur Eröffnung der Münchner Opernfestspiele
Eine edle Leiche mehr
Die Uraufführung von Aribert Reimanns "Lear"
Die Münchner Staatsoper begann ihre diesjährigen Opernfestspiele nicht, wie meist, mit einem klassischen Evergreen, sondern mit einer Uraufführung, die sie sogar selbst in Auftrag gegeben hatte: Aribert Reimanns "Lear". Ein löbliches, im kulinarischen München nicht selbstverständliches Unternehmen. Was dabei herauskommt, ist immer Glücksache, und auch diesmal dürften, trotz des starken Premierenbeifalls, mit dem neuen Werk weder der Gegenwartsoper neue Wege gewiesen noch dem zeitgenössischen Repertoire eine lebensfähige Oper hinzugewonnen worden sein. Kaum ein anderes Opernhaus wird wohl das Stück so glanzvoll besetzen können wie hier mit Fischer-Dieskau in der Titelrolle.
Die Aufführungsschwierigkeiten sind musikalisch größer als szenisch. Jean Pierre Ponelle, wieder Regisseur und Ausstatter in einer Person, kam denn auch mit einer Einbesetzszene aus: eine mäßig verwandelbare karge Landschaft aus Fels und Schilf, aller Illusionsromantik entrückt durch sichtbare Scheinwerfertürme und Bühnenapparatur. Die Musik hält sich durchaus im Rahmen der Tradition. Daß für die Riesenpartitur ein eigenes Dirigentenpult konstruiert werden mußte, ist bloße Äußerlichkeit.
Aribert Reimann, 42 Jahre alt, einstiger Blacher-Schüler, kommt in dieser seiner dritten Oper nach dem Strindberg-"Traumspiel" und der "Melusine" - mit dem üblichen spätromantischen Orchester aus, und was er ihm zumutet, nämlich geballte Ladungen von Tontrauben, auch vierteltönigen, vielstimmigen Bläserakkorden und gleitenden Klangfächern (mehrdutzendfach geteilte Streicher!), ist so ungewöhnlich nicht.
Zimmermanns "Soldaten" gaben sich viel aggressiver in den Phon-Attacken aufs Trommelfell, und von der Anti-Oper Kagels oder Ligetis (vor dem "Grand Macabre") trennen Reimmann schon gar Welten. Bei ihm ist das Orchester immer noch psychologischer Resonanzboden; die Singstimme dient auch im atonalen; reihentechnisch gebauten Melos dem seelischen Ausdruck. Insofern wird da die Linie Wozzeck-Moses und Aron-Soldaten weitergeführt, wobei Reimmann gegenüber Zimmermann sogar durch den Verzicht auf Elektronik konservativer bleibt. Er klammert sich stärker, nachdem er schon einmal Abschied von der Zwölftonmusik genommen hatte, an die alten esoterischen Geheimkünste der Reihentechnik, mit Umkehrung und Krebs und Kanon, die allesamt bloß auf dem Papier stehen. Auch in der Behandlung der Singstimme; von den reiheptypischen, unkantablen Zackenlinien bis zum gesprochenen Wort, hält sich Reimann an die Klassiker Berg und Schönberg. Alles wie längst gehabt und längst historisch geworden.
Verspäteter Hochexpressionismus ist der vokale und instrumentale Dauerschrei, mit zuckenden und peitschenden Clustern im Orchester, und lyrischen Oasen dazwischen, die dann doppelt wohltun. Nicht die Phongewitter in der berühmten Shakespeare-Szene des Königs auf der sturmgepeitschten Heide klingen am eindrucksvollsten, sondern die Koloraturen des gespielten Wahnsinns - außerordentlich der Kontra-Tenor David Knutson, der als Edgar virtuose Kehlkopf-Akrobatik bis zum hohen Fis leistet -, die stille Arie der Cordelia (Julia Varady) oder die Klage des sterbenden Königs mit ihren ausdrucksreichen Vokalisen.
Shakespeares tief pessimistisches Drama von Undank, Wahn und Machtgier der Menschen richtete Claus Henneberg mit radikalen Raffungen zu einem vertonbaren Text ein. Freilich werden durch die Verknappung viele Figuren zu Marionetten und die im 2. Teil hinzugefügten Simultanszenen erleichtern es dem Inszenator auch nicht, die verwickelten Intrigen plausibel ins Einheitsbild zu bringen. Es kommt doch wohl nicht von ungefähr, daß sich von allen großen Shakespeare-Tragödien "King Lear" am hartnäckigsten wirksamer Veroperung entzog; selbst der spätere Falstaff- und Otello-Meister Verdi scheiterte ja daran.
Ponelle entwarf bizarre Kostüme mit Beatleköpfen für die Gloster-Söhne und profilierte die Figuren mit knappen, gewissermaßen archaischen Gesten. Daß Dietrich Fischer-Dieskau dem Lear, vor dem selbst die bedeutendsten Mimen der Sprechbühnen oft zurückschraken, so glaubhaft genügte, spricht auch für den Regisseur. Die Gesangspartie hatte Reimann seinem Freund sozusagen auf den Stimmleib geschrieben. Grenzen des hellen Baritons wurden höchstens in der orchesterexplosiven Heide-Szene gestreift. In der Vielfalt der sängerischen Nuance, in der Geschmeidigkeit der Register ist Fischer-Dieskau auch auf der Bühne Bariton-König.
Neben ihm hochrangige Besetzung: Helga Dernesch und Colette Lorand als böse Schwestern, Hans Günter Nöcker als antikisch-tragischer Gloster, Werner Götz als Edmund, ein wahrer Opernschurke. Erstaunlich schlecht verständlich sprach Rolf Boysen den Part des melancholischen Shakespeare-Narren. Am überdimensionalen Dirigentenpult sorgte Gerd Albrecht wie ein Verkehrspolizist für Klangordnung. Mit energischen, zackigen Gesten und Schlägen, die mit Karate-Wucht scharfe Formen aus dem vielstimmigen Tohuwabohu zu meißeln schienen. Der Beifall war, wie schon erwähnt, stark und fast einhellig. Man hatte sich eben inzwischen an viel stärkeren Tobak gewöhnt und empfindet so eine edelpathetische Zwölftonoper als erträglich. Ob aber außerhalb von Festspielen viele Leute zweimal hineingehen werden? Ob der erhabene Musik-Lear nicht doch bald als edle Leiche im Opern-Massengrab verschwinden wird?
Kurt Honolka
Kölner Rundschau, 11. Juli 1978
Vision von Wahn und Sühne
Münchener Opernfestspiele mit Reimanns "Lear" eröffnet
Die Vorausfama für die Uraufführung von Aribert Reimanns Oper "Lear" zu Beginn der diesjährigen Münchener Opernfestspiele hatte so sehr für Unruhe gesorgt, daß man sich bei der Premiere im Nationaltheater am Sonntag beinahe schon auf einen Skandal gefaßt machte.
Inzwischen hat das Werk seine Feuertaufe glänzend bestanden. Stürmischer Beifall dankte vor allem dem Komponisten, seinem musikalischen Interpreten Gerd Albrecht, dem Regisseur Jean-Pierre Ponnelle und, mit besonderem Nachdruck, dem Darsteller der Titelrolle Dietrich Fischer-Dieskau, der dem Werk von Anfang an als Anreger und Pate verbunden war.
Große Spannweite
Selten erlebte man seit den letzten Carl Orff-Uraufführungen eine so einleuchtende Durchdringung aller "Nervensysteme" einer Oper aus einem zentralen Ausstrahlungskern. Bei Reimann ist es jedoch nicht der Rhythmus, der sich von diesem Kern in alle Ausdrucksbereiche ausbreitet, es ist vielmehr die "Klangpsyche" seiner Partitur. Man spürt durchgehend den intensiven inneren Bezug von der Musik zu allen anderen Ausdruckskategorien.
Groß ist die Spannweite der Stimmungen von der brutalen Verstoßung des Lear bis zu dessen resignierend-lyrischer Verzweiflung. Erschütternd die Wiederbegegnung von Fischer-Dieskaus entmachtetem König mit Julia Varady als Tochter Cordelia.
Ideale Besetzung
Viel verlangt der Komponist von seinen Solisten und auch von den Orchestermitgliedern: Gesangsintervalle von bizarrer Exaltiertheit, irre Stakkati, melodramatische Ausbrüche von brüsker Brutalität, dann aber auch wieder verhaltene monotone Lyrismen. Zwölftonreihen verkrallen sich im Duett oder im polyphonen Gefüge ineinander; instrumentale Klangfelder haben eine solche Differenzierung, daß zeitweilig jeder Geiger, Flötist oder Blechbläser zu seinem eigenen Solisten wird. (Die Partitur weist gelegentlich über 50 Stimmen auf.)
Ganz im Gegensatz zu den großen Opern des 19. Jahrhunderts nach Shakespeare lebt Reimanns "Lear" kaum von der Dramatik theatralischer Bewegung. Sie ist zwar auch erkennbar, aber wo es auch immer die musikalischen Mittel erlauben, wird sie durch den ekstatischen Gesang und durch die Klangbewegungen des Orchesters mit ihren Hell-Dunkel-Spannungen oder mit ihren geheimnisvollen düsteren Wellenbewegungen ausgedrückt.
Jean-Pierre Ponnelle hat diesen Wesenszug der Oper voll erkannt und daher eine sehr statische Inszenierung angestrebt, bei welcher das Spiel nur von der musikalischen Diktion motiviert wird.
Ideal die Besetzung: Fischer-Dieskau gibt den Lear in einer Ausdrucksbreite, die von der resoluten Vateransprache bis zum nervösen Wahnsinnsausbruch und zur leisen Totenklage um Cordelia mühelos alle Farben zutage bringt. In weiteren Rollen schufen Julia Varady, Helga Dernesch, Colette Lorand, Rolf Boysen und (mit einem bestechenden Kopfstimmentenor) David Knutson treffende Porträts.
Die deutsche Oper ist um ein Werk reicher geworden, bei dem sich moderner Impetus und atemberaubende Publikumswirkung auch in einem breiteren Kreis nicht gegenseitig ausschließen.
Klaus Colberg
"Oper und Konzert", München, 8/1978
Nationaltheater
Lear - Uraufführung
Eine der packendsten Shakespeare-Aufführungen, die man seit Brooks und Strehler sah, eröffnete die Münchner Opernfestspiele 1978: Jean Pierre Ponelle inszenierte "König Lear" - teilweise neu übertragen und dramaturgisch eingerichtet von Claus H. Henneberg - in einer selbstgeschaffenen Einheitsheide im offenen Bühnenhaus; Erde, Steine, Schilf und Binsen hoben und senkten sich und versinnbildlichten in variabelster Beleuchtung bei den als unspielbar geltenden "Heideszenen" Verfremdung und Innen-Stürme unter kosmischer Katastrophe. Man durfte hundert gelöste "Lear"-Rätsel bestaunen (und hundert ungelöste ahnen) in dieser menschennahen und seelenkundigen Deutung, die Fallhöhe und Härte der Tragödie, der Zusammenstoß zwischen Gunst und Gier waren nachvollziehbar. Mag auch die englisch-politische Komponente des Stückes nicht so spürbar geworden sein wie die große mythologische, so machte die Aufführung in jedem Augenblick das Leid der Geschöpfe, die Orgie von Haß und Blut, die Exzesse von Verrat und Mord glaubhaft; die Eiseskälte eines einsamen Schicksals wehte uns an. Und mit Adalbert Stifter ("Nachsommer") durfte man sagen, daß im Nationaltheater ein Künstler wirkte, "von dem der Ruf sagt, daß er in der Darstellung des König Lear das Höchste leiste, was ein Mensch in diesem Kunstzweig zu leisten imstande sei...": König Lear war Dietrich Fischer-Dieskau. Denn in dieser faszinierenden Shakespeare-Aufführung wurde - u.a. - auch gesungen. Die Bayer. Staatsoper hatte nämlich den von Verdi um 1860 leider fallen gelassenen, von Aribert Reimann vor 10 Jahren gefaßten Plan, "Lear" zu vertonen, als Auftragswerk für die Festspiele 1978 konkretisiert. Und ließ ihm eine Verwirklichung angedeihen, die das Wort vom "Großen Theaterabend" rechtfertigt.
Wer hat wen nötig?
Über Reimanns Partitur ist schon vor der Uraufführung schriftlich und mündlich weidlich polemisiert worden: der Abend endete mit einem schier einspruchslosen Triumph für Komponisten und Mittler. Aribert Reimann bedankte sich bei allen höflichst; vor allem sollte er einen Kranz in Stratford niederlegen. Denn er hat Shakespeare viel, fast alles zu verdanken. Und etwas abgewandelt könnte man Schopenhauers Wort zitieren, es sei verwerflich, durch den Stoff in den poetischen Fächern zu wirken, wo doch das Verdienst des Autors ausdrücklich in der Form liegen solle. Mit anderen Worten: "Lear" ist ein solch ungeheurer dichterischer Vorwurf, daß er auf der Opernbühne nicht nur jede Vertonung aushält, sondern sie trägt, ja ihr zum Erfolg verhelfen muß. Reimanns "Musik" ohne Shakespeares Visionen: was bliebe da...
Eine phänomenale Interpretation
Nach dem Motto "Uraufgeführt zu werden ist nichts, nachgespielt zu werden ist alles" seien leise Zweifel an der Haltbarkeit des Erfolges angemeldet. Das Werk ist durch Fischer-Dieskau inspiriert und auch auf seine Persönlichkeit hin komponiert worden. Und einen vollkommeneren Interpreten wird Reimann nicht finden können; man darf ihn ruhig an Werner Krauss messen. Da war das Herrscherliche, wenn er sein Reich aufteilt, die enttäuschte Liebe und Wut, weil Cordelia die Schmeicheleien ihrer Schwestern nicht nachäfft, der aufkeimende Wahnsinn - und als das Unglück den König in einen ebenso verzweifelten wie heiter-hilflosen Greis verwandelt hatte, da schuf Dietrich Fischer-Dieskau in ganz nach innen gelebter Trauer einige der erschütterndsten Momente des heutigen Theaters. Er schleppt seine ermordete Tochter vor sich her, weil die Arme sie nicht mehr tragen ... und zu diesem Inbegriff des Leidens ist Reimann auch eine unerhört intensive Streicherlinie in den Sinn gekommen, der einzige Augenblick, wo er Shakespeare Wesentliches zubringt, nicht nur von ihm borgt.
Helga Dernesch als hochdramatische Goneril, Colette Lorand als mit eiskaltem Koloraturfeuerwerk fesselnde Regan haben ein fulminantes Rache-Verschwörer-Duett, echte alte Oper, nur eben verfremdet. In dem hoch informativen Programmheft (Redaktion Klaus Schultz) sind vier Takte unter Beispiel VI abgedruckt und man hört beim Lesen, wie "schön" es klingen könnte, wenn Reimann sich so zu schreiben traute, wie er wohl möchte, aber wie er halt in unserem Jahrhundert, unterm Damoklesschwert der avantgardistischen Kritiker-Mafia, nicht mehr darf. Da muß also die eine Fis, die andere Gis singen, dann H und C, D und Es, nur damit der melodische Impetus falsch klingt, obwohl die Emotion, die dahinter webt, zweifelsfrei aus traditionellen Opernquellen gespeist wird.
Julia Varady ist eine Cordelia aus königlichem Blute, natürlicher Stolz und ein einfaches Herz sind ihr eigen - und eine vox celestis: alle Schmerzenskinder dieser Erde dürfen sie als Gefährtin im Leide grüßen. Wunderbar, wie sie ihre so farbenreiche Stimme ganz in den Dienst des Ausdrucks ihr sicher ganz fern liegender Musik zu stellen vermag.
Überraschend wenig konnte die Regie mit dem Narren anfangen: bis zur Unkenntlichkeit verschminkt konnte selbst Rolf Boysen, dieser doch wahrlich große Schauspieler, der Rolle wenig Bühnenleben geben. Ein großer Augenblick: Hans Günter Nöcker als geblendeter Gloster auf den Klippen von Dover, auf der Pyramide seines Unglücks. Daß Edgar dem Countertenor David Knutson auf die hohe Stimme geschrieben ist, verwunderte mich etwas; die Assoziation an Mussorgskys Narren in "Boris" liegt dann sehr nahe. Effektvoll schwankte zwischen Jago und Tenorliebhaber alten Stils Werner Götz als Edmund. Und noch jede Nebenrolle war eindrucksvoll besetzt: Richard Holm als Kent, Hans Wilbrink als Albany, Georg Paskuda als Cornwall und Karl Helm als Frankreich. Für die maßlos schwierigen Chöre muß Josef Beischer viel Arbeit investiert haben.
Gerd Albrecht vollbrachte mit dem erstaunlich bereitwillig mitgehenden Bayer. Staatsorchester wahre Klangwunder; so weit man das nach erstem Hören beurteilen kann, scheint er ein idealer Anwalt Reimanns zu sein. Aber die Partitur ist für alle aberwitzig kompliziert, wohl nur an ersten Bühnen spielbar. Gut, das war "Tristan" auch einmal - und nach einer Generation spielte man ihn schon in Regensburg. Aber zahlt sich solche Mühe für "Lear" aus, wird er sein Publikum finden?
[...]
Dr. Klaus Adam
___________________________________
Basler Zeitung, 19. Juli 1978
"Lear" als Oper
Unter einem besonderen Akzent stehen in diesem Jahr Münchens Opernfestspiele: Auf der Bühne des Nationaltheaters bringt die Bayerische Staatsoper Aribert Reimanns "Lear", Oper in zwei Teilen nach William Shakespeare, zur Erstaufführung. Eine außergewöhnliche Leistung, die dennoch nicht ganz unter die Haut ging.
Dietrich Fischer-Dieskau, mit dem der 42jährige Berliner Komponist seit langem beruflich und persönlich verbunden ist, hatte das Projekt vor zehn Jahren angeregt und es bis zur Uraufführung in aktiver Anteilnahme verfolgt; den konkreten Anstoß zur Komposition gab dann Münchens Staatsopernintendant August Everding, der Reimann 1975 einen entsprechenden Auftrag erteilte. Angesichts der komplexen Vorlage und der gattungsbedingten Probleme der zeitgenössischen Oper, aber auch der Schwerfälligkeit des Opernbetriebes und der Traditionsversessenheit des großen Publikums sind die Beteiligten ein beachtliches Risiko eingegangen, das sich indessen über alle im einzelnen gewiß möglichen Einwände hinweg gelohnt hat: Nicht nur, daß Premiere und erste Wiederholung, von der hier die Rede ist, zu einem ungetrübten Erfolg gerieten - das Unternehmen scheint einen wichtigen Punkt in der Operngeschichte des 20. Jahrhunderts zu markieren, indem es Fragen aufwirft, die zu einer erneuten Belebung der Diskussion um das Opernschaffen unserer Tage führen könnten.
Ein schwieriger Stoff
"King Lear" als Oper: Das heißt, einen großen Stoff und eine höchst spezifische dramaturgische Anlage umzudenken in die Kategorien der Musikbühne mit ihren wiederum ganz andersartigen Gesetzmäßigkeiten. Ist das überhaupt möglich, ohne das Shakespearesche Drama seiner nach wie vor schauerlichen Unmittelbarkeit, seiner ungeschminkten Brutalität oder der psychologischen Differenzierung zu berauben? Auch wenn Giuseppe Verdi, sonst im Umgang mit Schauermären nicht eben zimperlich, vor bald 150 Jahren entsprechende Bemühungen nach mehr als zehnjähriger Auseinandersetzung mit dem Stoff und dem Librettisten Antonio Somma aufgegeben hat, braucht die Frage heute nicht von vornherin verneint zu werden, denn die musikalische Sprache der Gegenwart stellt in der Tat Mittel zur Verfügung, die sich zum Ausdruck derart extremer Vorgänge, wie sie den "Lear" kennzeichnen, durchaus eignen können. Dennoch bleibt zunächst zu fragen, wie sich Reimanns "Lear" der Shakespeareschen Vorlage gegenüber verhalte.
Verlust der Zwischentöne
Angesichts der Gegebenheiten der Operndramaturgie liegt auf der Hand, daß der Text erheblich bearbeitet werden mußte - eine Aufgabe, der sich Claus H. Henneberg mit außerordentlichem Geschick unterzogen hat. Ausgehend von Johann Joachim Eschenburgs "Lear"-Übersetzung aus dem Jahre 1777, deren sprachlichen Ausdruck er den heutigen Gewohnheiten anpaßte, ohne in Modernismen zu verfallen, erreichte der Librettist die notwendige Straffung auf drei Ebenen: nicht nur durch Kürzung, Veränderung des dramaturgischen Stellenwerts (Kent) oder gänzliche Streichung (Oswald), sondern auch durch die Einführung von Handlungssimultaneität und Kompilation (die verschiedenen Heide-Szenen wurden zu einem Bild zusammengefaßt).
Insgesamt versuchte Henneberg, "von Shakespeares Text wegzunehmen, was die Musik ausdrücken kann": Daß eine derartige Straffung auf den Verlust der Zwischentöne hinauslaufen mußte, war vorauszusehen. Ihre markanteste Manifestation findet diese Tendenz in der Figur des Lear, dessen psychologische Entwicklung im Vergleich zu Shakespeare weitaus weniger differenziert erscheint, aber auch in jener des Narren, dessen Funktion als Lears grotesk verzerrtes Spiegelbild merklich geschmälert ist.
Prägnante Charakterzeichnung
Derartigen Reduktionen vermag nun die Musik kaum neue Dimensionen entgegenzusetzen, wogegen sie das im Libretto Vorgezeichnete in gekonnter Machart nachvollzieht: Sie ist im besten Sinne dramatisch, insofern nämlich, als sie sich über das Begleiten der Handlung hinaus eine eigenständige dramaturgische Funktion schafft. Mit seinen musikalischen Mitteln kennzeichnet Reimann die einzelnen Charaktere in prägnanter Weise; die beiden bösen Töchter Goneril und Regan etwa singen in ihrem fast hysterischen Machtanspruch virtuos ausladende Linien, während sich Cordelia mit enger gezogenem Ausdruck bescheidet. Auch Verhaltensweisen und Emotionen finden ihr exakt definiertes musikalisches Korrelat: In seiner Verstellung vor dem Vater wechselt Edgar vom Tenor ins Falsett des Countertenors, und in Momenten höchster Erregung (etwa wenn Cordelia nicht in der Lage ist, ihrer Vaterliebe den gewünschten Ausdruck zu verleihen) greift die Sprechstimme Platz. Daneben versteht Reimanns Musik, Augenblicke von beeindruckend intensiver Stimmung zu schaffen; die große Heideszene am Schluß des ersten Teils und die Sterbeszene Lear/Cordelia gehören hierzu und werden dem Zuschauer im Gedächtnis bleiben.
Dennoch hinterließ der Abend in seiner Gesamtheit nicht jene Beklemmung, die sich aus der Aufführung des Shakespeareschen Dramas oder auch nach dessen Lektüre ergibt. Das lag gewiß nicht an der Realisation des Werks auf der riesigen Bühne im Münchner Nationaltheater, die unter der Verantwortung von Gerd Albrecht (musikalische Leitung), Jean-Pierre Poonnelle (Inszenierung und Bühnenbild) und Pet Halmen (Kostüme) entstanden war. Ponnelles Bühne war gleichsam leergefegt: Kulissen fehlten ebenso wie Bauten, die Requisiten ließen sich an einer Hand aufzählen, man spielte vor den unverstellten Beleuchtungstürmen und der nackten Hinterwand. Der Boden, als eine üppig wuchernde Heidelandschaft mit verstreuten Felsbrocken und bizarren Sträuchern gestaltet, hob und senkte sich in einzelnen Segmenten zu Palästen, Hütten und Gruften; dazu trat, wie immer bei Ponnelle, eine meisterhafte Ausleuchtung. Die Inszenierung - von Ponnelles natürlicher Personenführung wird nicht mehr die Rede sein müssen - nahm die im Libretto angelegte Tendenz zur Simultaneität auf, indem, was bei Shakespeare etwa von Oswald berichtet wird, seine szenische Darstellung fand, indem aber auch immer wieder Lear, Gloster oder Edmund gleichzeitig zum Hauptgeschehen über die Bühne irrten und damit die Brutalität der Abläufe in Erinnerung riefen.
Hervorragendes Sängerensemble
Von nicht geringerer Eindrücklichkeit die musikalische Seite der Aufführung. Gerd Albrecht hatte mit dem Bayerischen Staatsorchester hart und unerbittlich gearbeitet, was seine Früchte in Form einer, soweit sich das verfolgen ließ, untadeligen Leistung im Orchestergraben fand - und das ist angesichts der Komplexität dieser Partitur nicht zu unterschätzen. Das hervorragend besetzte Sängerensemble wurde angeführt von Dietrich Fischer-Dieskau als Lear, der für seine weder die stimmlichen noch die darstellerischen Möglichkeiten schonende Leistung besonders gefeiert wurde. Großartig auch David Knutson als Glosters Sohn Edgar, der seine halsbrecherische Countertenor-Partie mit bewundernswerter Gelassenheit bewältigte. Helga Dernesch und Colette Lorand spielten die Versessenheit der beiden Töchter Goneril und Regan ebenso überzeugend aus wie Julia Varady (mit großartigem stimmlichen Ausdruck) die Unschuld Cordelias. In Erinnerung blieben neben Rolf Boysens krächzendem Narren Hans Wilbrink (Albany), Georg Paskuda (Cornwall), Karl Helm (König von Frankreich), Hans Günter Nöcker (Gloster), Werner Götz (Edmund) und Richard Holm (Kent).
Auf Distanz gesetzt
Daß Reimanns "Lear" dennoch nicht ganz unter die Haut ging, scheint zwei Ursachen zu haben. Zum einen lassen sich der Musik die dramaturgischen Qualitäten nicht absprechen und kann gegen die durchdachte und phantasievolle Faktur kaum etwas eingewandt werden - und doch dürfte just bei der Musik der Hase im Pfeffer liegen: Für einmal gehe ich mit dem in Sachen Musik sonst nicht außergewöhnlich kompeteten "Spiegel" einig, der zur Münchner Uraufführung schrieb, die "kunstvoll gefertigte Partitur des 150-Minuten-Stücks" wirke "vorwiegend getüftelt". Was der "Spiegel" nicht näher umschreibt, könnte Reimanns Leistung in der Tat schmälern: Die Partitur erscheint derart durchrationalisiert (da werden Klangflächen mit 48fach geteilten Streichern erzeugt oder egeben sich Polyphonien von kompliziertester rhythmischer Struktur), daß die Unmittelbarkeit in der Konstruktion untergeht - eine Behauptung, die sich aufgrund des Gehöreindrucks und eines Blicks in den (hier allerdings kaum relevanten) Klavierauszug wohl aufstellen, jedoch nur nach analytischer Betrachtung der Partitur untermauern läßt. Zum anderen läßt sich nicht übersehen, daß die Oper das Geschehen in jedem Fall um einige Grade verklärt, und das gilt auch hier: Die grausame Geschichte "vom König Lear und seinen drei Töchtern" wirkt im Ausdrucksbereich der Oper und einer trotz aller Härte geschmackvoll-schönen Inszenierung deutlich auf Distanz gesetzt - und es kommt wohl nicht von ungefähr, daß sich ein Zuschauer in dem der Aufführung folgenden Gespräch über Fischer-Dieskaus zu schönen Ausdruck aufgehalten hat. So gesehen ist "Lear" als Oper tatsächlich unmöglich.
Peter Hagmann
___________________________________
Lippesche Landeszeitung, 11. Juli 1978
Erfolg für "Lear"
"Abenteuerlich kunstvoll aufgebaute Partitur"
Zu einem einhelligen Publikumserfolg wurde die Uraufführung der Oper "König Lear" von Aribert Reimann, mit der am Sonntagabend die Münchner Opernfestspiele im Bayerischen Nationaltheater eröffnet wurden. Dem im Auftrag der Bayerischen Staatsoper komponierten Werk war schon der Ruf einer kompromißlosen und extrem aggressiven Musik vorausgegangen, so daß in diesem Jahr mit den Ehrengästen des Ministerpräsidenten Alfons Goppel ein vorwiegend sachverständiges und an moderner Musik interessiertes Publikum kam, das den Komponisten, aber auch den Dirigenten Gerd Albrecht und Regisseur Jean-Pierre Ponnelle mit dem Ensemble begeistert feierte. In der "Süddeutschen Zeitung" wurde Reimann bescheinigt, daß er "mit einer geradezu abenteuerlich kunstvoll aufgebauten, die extremen Klangwirkungen suchenden, auskostenden Partitur von eindringlicher Beredsamkeit" überzeugt habe.
Die Titelrolle sang Dietrich Fischer-Dieskau, von dem die Anregung zu der Oper ausgegangen war und der zusammen mit Julia Varady (Cordelia), Helga Dernesch (Goneril), Colette Lorand (Regan), David Knutson (Edgar), Werner Goetz (Edmund) und Hans Günter Nöcker (Gloster) immer wieder vor den Vorhang geholt wurde. Den "Narren", eine Sprechrolle, spielte der Schauspieler Rolf Boysen.
[...]
Autor unbekannt
___________________________________
Zeitung unbekannt, 11. Juli 1978
Moderne Klänge schreckten Opernfans nicht
Nur "Pflichtbesucher" blieben zu Hause
Die Münchner mußten bei ihren Opernfestspielen schon immer auf manches äußerliche Festspielgepränge verzichten. Auch am vergangenen Sonntag kamen diejenigen nicht auf ihre Kosten, die an den feierlichen (Bayreuther) Aufmarsch der Prominenz gewöhnt sind, oder an Schaulustige, die mit Kennerblick den Eingang zum Theater umlagern.
Diesmal waren sie vielleicht noch ein bißchen mehr als sonst unter sich, die Fans, die bei jedem großen Theaterereignis zu finden sind. Nicht alles, was sich sonst hier zur Festspielzeit zeigt, war zur Uraufführung von Aribert Reimanns Auftragsoper "Lear" erschienen. Ob manche der "Pflichtbesucher" durch das (ungerechtfertigte) Gerücht verhindert waren, man müsse für dieses neue Musikdrama einen gesunden Magen haben? Dennoch, um die Opernzukunft brauchen weder der Komponist noch die Theaterleute zu bangen.
Die Vorstellung war total ausverkauft und bis zum Opernbeginn drängten sich vor der Theaterkasse vergeblich hoffende Kartenanwärter. Sie konnten sich schließlich nur zu Hause mit der Rundfunkübertragung des Festspielereignisses trösten.
Nicht schrecken von modernen Klängen ließen sich der bayerische Ministerpräsident, der Münchner Oberbürgermeister, der Kultus- und Wirtschaftsminister und etliche Botschafter aus nahen und fernen Kontinenten.
Daß etliche Musik- und Theaterprominenz erschien, ist ohnehin selbstverständlich. Festlich flanierte man dann in der Pause durch die Nationaltheatergänge, kein Exodus der Besucher, wie ihn manche Pessimisten befürchtet hatten, störte die gespannte Premierenstimmung. Auch ihre Festbekleidung hatten die meisten Besucher dem bedeutsamen Theaterereignis angepaßt. Immerhin: Auch Jeans- und Pulloverträger wurden gesichtet und toleriert. Und nicht zuletzt am enormen Champagnerdurst der Besucher (sie tranken 30 Prozent mehr als sonst) zeigte sich die gute Festspielatmosphäre.
Nach der Aufführung trafen sich dann die Auserwählten aus den Reihen der Künstler zum Premierenempfang im Antiquarium vor und hinter Tischen mit ausgesuchten kalten Leckereien. Nicht dabei unter den Antiquariumsgästen waren zwei der Opern-Hauptdarsteller: Das Ehepaar Fischer-Dieskau/Varady feierte die rundum gelungene Aufführung lieber zu Hause.
Irmi Schwartz
___________________________________
Musica 5/78
Erhöhung durch übermäßiges
Leiden
Aribert Reimanns Oper "Lear" an der Bayerischen Staatsoper München
uraufgeführt
Verdi schrieb trotz einiger Anläufe keine Oper über Shakespeares "Lear"-Stoff (Franz Werfels Verdi Roman ist reich an Informationen und Spekulationen über diese schwierige Phase im Leben des Komponisten). Hundert Jahre später kam es nun dem 42jährigen Berliner Komponisten Aribert Reimann so vor, als seien Zeitläufe und Tonsprache einer profunden Beschäftigung mit dem düsteren Sujet entgegengereift. Dietrich Fischer-Dieskau gab die Anregung, die Bayerische Staatsoper erteilte den Auftrag: Reimanns "Lear", zur Eröffnung der diesjährigen Münchener Opernfestspiele uraufgeführt, wurde vom Premierenpublikum mit einheIligem Beifall aufgenommen.
"Lear" ist mit drei Stunden Spieldauer das bisher umfangreichste Werk Reimanns, der bereits 1965 mit der Strindberg-Vertonung "Ein Traumspiel" und 1971 mit dem feinsinnigen Märchen "Melusine" einigen Opernruhm erntete. Die Shakespeare-Tragödie folgt in der Librettofassung Claus H. Hennebergs einer wenig bekannten deutschen Übersetzung von Johann Joachim Eschenburg aus dem Jahre 1777; es wurde stark gekürzt, ansonsten aber nicht viel verändert (z. B. wurden die Heideszenen zu einem einzigen großen Tableau zusammengezogen). Reimann interpretiert die Handlung, indem er sich weitgehend mit der Figur Lears identifiziert: "Isolation des Menschen in totaler Einsamkeit, der Brutalität und Fragwürdigkeit allen Lebens ausgesetzt". Diese "existentialistische" Sicht läßt befürchten, daß Lear hier als ein ungebrochen tragischer Held vorgeführt wird, daß Kritik an seiner paternalistischen Haltung nicht aufkommen kann. Immerhin hat er ja durch seinen mit einer "Gewissensprüfung" der Töchter verbundenen Thronverzicht die ganze Vernichtungsmaschinerie erst in Gang gesetzt.
In der Oper steht die Titelfigur so sehr im Vordergrund, daß neben ihr alle anderen Gestalten verblassen und die Dynamik der Tragödie verkürzt erscheint. So werden die beiden älteren Töchter auch musikalisch recht flach als schreckliche Monster gezeichnet. Lear selbst erhält mehr und mehr eine Aureole, wird zum Denkmal der Klage und Weltanklage, zu einer schmerzlich verklärten überdimensionierten Vaterfigur an der Leiche der "guten" Tochter Cordelia. Man sieht einen schwer geschlagenen großen alten Mann, der von Szene zu Szene durch ein Obermaß an Leiden sozusagen metaphysische Würde erhält. Die auch von Edward Bond in seinem "Lear"-Drama betonte politische Komponente interessiert die Opernautoren in ihrer Fixierung auf Lears Rigoletto-Züge also offenbar kaum. Die Versuchung zur Hypertrophierung der Leargestalt ist sicher auch darin begründet, daß Fischer-Dieskau mit dieser Rolle noch einmal alle darstellerischen Register ziehen wollte und eine Figur auf die Bühne zu stellen beabsichtigte, in der die geschundene Kreatur Wozzeck ebenso wie der idealtypische "Narr in Christo" aufgehoben wäre. Die Partitur läßt die vielfältigsten Erfahrungen erkennen, die der Autor auch als Liederkomponist machte. Reimanns Vokalstil wirkt denn auch gekonnt und eigenständig, ohne freilich die auratische Qualität von Luigi Nonos magisch-realistischen Gesangslinien erreichen zu können. Die oft wild zerklüfteten instrumentalen Partien werden durch kunstvolle mikropolyphone Strukturen aufgebaut. Es kommt zu beträchtlichen Akkordballungen und signalartigen Tutti-Eruptionen, die allerdings die Gewaltförmigkeit der turbulenten Passagen aus Zimmermanns "Soldaten" an keiner Stelle etwa übertrumpfen, wie es vor der Aufführung werbewirksam verlautete. Insgesamt handelt es sich bei "Lear" um eine unbezweifelbar zeitgenössische, avancierte Opernmusik, die wichtige Anregungen der letzten Jahrzehnte verarbeitet, aber ebensowenig auf Neues hindeutet wie die herkömmliche Dramaturgie.
In München schienen alle Bedingungen für eine angemessene Wiedergabe vorhanden. Jean Pierre Ponnelle sorgte nicht nur für markante Akzente bei der Personenregie, sondern hatte auch einen attraktiven Bühnenraum hergestellt: eine flexible Bodenfläche mit steiniger Graslandschaft, allgegenwärtige mythische Heidestimmung, über der sich freilich kein Gewitterhimmel wölbte, sondern die nüchtern metallischen Stege, Galerien und Gerüste des Bühnenhauses sichtbar wurden. Charakteristische Timbres bei den Sängern: Helga Dernesch und Colette Lorand als die machtbesessenen Töchter, Julia Varady als seraphinische Cordelia, Werner Götz als bleckend tenoraler Bösewicht Edmund, David Knutson als sein lyrisch knabenhafter Gegenspieler Edgar.
Weit mehr als alle anderen hat Dietrich Fischer-Dieskau als Lear Gelegenheit zu facettenreicher Darstellung: mit visionärem Vater-Pathos, mit belkantistischen Meditationen wie mit kichernder und quengelnder Narrenpose kann er seine Glanzrolle aufbauen. Durch ihn wird diese Literaturoper zur Staroper - zweifellos auch mit den Gefahren, die das mit sich bringt.
Die musikalische Leitung war bei Gerd Albrecht in besten Händen. Das Orchester (der Chor spielt nur eine bescheidene Rolle) nahm sich der sehr differenzierten Tonsprache Reimanns insgesamt sorgfältig an, achtete auch auf Klangschönheit, was für die zahlreichen lyrischen Episoden (sie lassen die beträchtliche Liedbegabung Reimanns erkennen) besonders wichtig ist. So wurde Reimanns neues Werk nicht nur an einem prominenten Ort, sondern auch in einer mustergültigen Interpretation ans Licht der Welt gebracht.
Hans-Klaus Jungheinrich
___________________________________
Das Orchester, 9/78
Eröffnung der Münchner Opernfestspiele
Aribert Reimanns "Lear" am Nationaltheater uraufgeführt.
Die Münchner Opernfestspiele 1978 wurden mit der Uraufführung des "Lear" eröffnet, einem Werk, das Aribert Reimann als Auftragsarbeit für die Bayerische Staatsoper schrieb, angeregt von Dietrich Fischer-Dieskau und eingerichtet von Claus H. Henneberg.
War es überhaupt möglich, zu den tragischen Dimensionen dieses Werkes eine Form des musikalischen Ausdrucks zu finden? Bekanntlich hatte schon Verdi den Plan, Shakespeares "Lear" zu vertonen, ließ aber wieder davon ab. Vielleicht mußte erst eine Zeit heranreifen, in der die schier unbegrenzten Mittel eines musikdramatischen Pluralismus Gestaltungsmöglichkeiten für einen Läuterungsprozeß solchen Ausmaßes verfügbar sein würden; denn der Dornenweg durch eine unerbittliche Katharsis ist das Thema dieser Tragödie und Reimann hat hier sehr genau aus dem Kern des ungeheueren literarischen Vorwurfs heraus seine musikalische Konzeption entworfen, welche sich in eine Entwicklung eingliedern läßt, die von Bergs " Wozzeck" über Zimmermanns "Soldaten" führt. Wie über diesem, von Altersstarrsinn und Selbstbestätigungsdrang gezeichneten König, durch das Verstoßen der Lieblingstochter Cordelia, der ganze Weltschmerz hereinbricht, ein Weltschmerz, der nur im Wahnsinn noch Erlösung finden kann, das erfordert eine Partitur, in der sich Schonungslosigkeit und Mitgefühl paaren. Reimann, vom Lied kommend, versteht es, die Spannung zwischen den heftigsten Klangextasen und melismatischen, ja lyrischen Passagen zu halten, und immer achtet er auf die menschliche Stimme, räumt ihr innerhalb abstraktester Gebilde eine gewisse Entfaltungsmöglichkeit ein. Die Mittel sind der Grenzenlosigkeit des Stoffes angepaßt, der Orchesterapparat (ohne elektronisches Zubehör!) wird voll ausgenützt, von den irrlichternden, geteilten Streichern und den Klangtrauben der Bläserkaskaden, bis zu "verschmutzten Akkorden" (vom Dirigenten der Uraufführung so bezeichnet, wenn die Blechbläser angehalten sind, falsche Töne zu erzeugen) und einem monströsen Schlagwerk, befindet sich alles im Einsatz, und strenger Zwölftonsatz wechselt mit völlig freier Anwendung harmonischer und disharmonischer Praktiken.
An dieser Stelle muß der Librettist Claus Henneberg genannt werden, ihm ist eine Textfassung geglückt, die Shakespeares "Lear", ohne Substanzverlust, noch einmal verdichtet und damit für eine Überhöhung durch Musik in beispielhafter Weise anbietet. Nur einem ebenso dramaturgisch wie musikalisch absolut sattelfesten Praktiker kann das gelingen. Daß Reimann nach mehr als zwei Stunden expressiver Klangkombination noch die Kraft aufbringt, das erschütternde Ende durch ein besonders inspiriertes, breites, weitausholendes Streicherthema emotional vorzubereiten, spricht für die schöpferische Intuition und Eigenständigkeit dieses Komponisten! Eine Uraufführung ohne Einwände wird es kaum geben können, daß diesen Einwänden hier jedoch wenig Platz eingeräumt werden soll, ist der Tatsache zuzuschreiben, daß sie in Relation zu dem überwältigenden Gesamteindruck ohne großes Gewicht sind. Trotzdem: Beharrt man in kurzen Abständen auf extremer Lautstärke, nützt sich der Effekt ab. Ein Zugeständnis an die Gattung Oper sind die Chorauftritte. Eigentlich bringen diese Soldatenchöre die Handlung aber nicht weiter, sie verdeutlichen auch nichts, denn man kann den Text überhaupt nicht verstehen.
In Superlativen kann über die Wiedergabe berichtet werden: Jean-Pierre Ponnelle hat in seiner szenischen Konzeption, die von der Regie bis zu den Bühnenbildern reicht, eine beinahe unheimliche Geschlossenheit erzielt. Die Bühne wird in ihrer ganzen Höhe und Tiefe sichtbar gemacht, Beleuchtungstürme stehen gespenstisch an den Rändern des Spielfeldes, das die Heide als ein Symbol steinig-versteinerter Natur darstellt, im Sturm hydraulisch bewegt und aufgebrochen. Bei Ponnelle hat auch die perfektionierteste Technik noch Poesie, er schafft Bilder von visionärer Intensität und theatralischer Sinnlichkeit, unterstützt von Pet Halmens phantasievollen Kostümentwürfen. In der Personenregie gelingt Ponnelle sehr viel, aber nicht alles: besonders gut geführt sind Rolf Boysen, der den Narren mit zerbrochener Stimme und einem grenzenlos resignierenden Blick in die Zukunft zu spielen versteht, David Knutson (Countertenor), der aus dem Edgar ein mitleiderregendes Geschöpf macht, Richard Holm, der seine ganze darstellerische Eindringlichkeit dem Kent verleiht, Hans Günter Nökker als den um sein Augenlicht gebrachten Gloster und Werner Götz, den Ponnelle geradezu mit hysterischer Mordlust ausstattet. Schwerer hat es Ponnelle mit Dietrich Fischer-Dieskau, der in der Titelpartie wahrhaftig fasziniert, jedoch nicht immer erschüttert, wie es ihm dann aber in der psalmodierenden Beweinung der toten Cordelia in grandioser Weise glückt. Bei den Töchtern liegt es nahe, daß man der Cordelia die meisten Differenzierungen abgewinnen kann, und wer würde das vollkommener machen, als Julia Varady! Helga Dernesch als Goneril und Colette Lorand als Regan sind so sehr auf Boshaftigkeit festgelegt, daß hier eine Gestaltung von Grund auf fixiert ist. Summarisch muß aber auf die gesanglichen und schauspielerischen Höchstleistungen hingewiesen werden, die für alle Akteure dieser Aufführungen gleichermaßen gelten.
Den riesigen Klangapparat steuert Gerd Albrecht, ein Dirigent, dem die graphischen Bilder moderner Partituren vertraut sind, der den Unerbittlichkeiten des Bühnengeschehens die Unerbittlichkeiten der Klangflächen, Intervallsprünge und Akkordschläge entgegensetzt, präzise Einsätze im Labyrinth der rhythmischen Verschiebungen zu geben in der Lage ist und nicht einen Augenblick die Übersicht verliert. Nicht genug zu loben ist dabei das Bayerische Staatsorchester, das in den ungetrübten, schier endlosen Jubel nach dieser denkwürdigen Premiere zusammen mit dem Komponisten und allen Mitwirkenden – einbezogen wurde.
Karl-Robert Danler
Sylter Rundschau, 12. Juli 1978
Zweifel an der Haltbarkeit
Uraufführung "Lear" bei den Münchner Opernfestspielen 1978
Eine der packendsten Shakespeare-Aufführungen, die man seit Brooks und Strehler sah, eröffnete die Münchner Opernfestspiele 1978: Jean Pierre Ponelle inszenierte "König Lear", in einer selbstgeschaffenen Einheits-Heide, die sich hob und senkte und in variabelster Beleuchtung bei den als unspielbar geltenden "Heideszenen" Verfremdung und Innen-Stürme unter kosmischer Katastrophe versinnbildlichte. Man durfte hundert gelöste "Lear"-Rätsel bestaunen (und hundert ungelöste ahnen) in dieser menschennahen und seelenkundigen Deutung, die Fallhöhe und Härte der Tragödie, der Zusammenstoß zwischen Gunst und Gier waren nachvollziehbar; mag auch die englisch-politische Komponente des Stückes nicht so spürbar geworden sein wie die große mythologische, so machte die Aufführung in jedem Augenblick das Leid der Geschöpfe, die Orgie von Haß und Blut, die Exzesse von Verrat und Mord glaubhaft.
Und mit Adalbert Stifter ("Nachsommer") durfte man sagen, daß im Nationaltheater ein Künstler wirkte, "von dem der Ruf sagt, daß er in der Darstellung des "König Lear" das Höchste leistete, was ein Mensch in diesem Kunstzweig zu leisten imstande sei...": König Lear war Dietrich Fischer-Dieskau; denn in dieser faszinierenden Shakespeare-Aufführung wurde – u.a. – auch gesungen. Die Bayerische Staatsoper hatte nämlich den von Verdi um 1860 leider fallen gelassenen, von Aribert Reimann vor 10 Jahren gefaßten Plan, "Lear" zu vertonen, als Auftragswerk für die Festspiele 1978 konkretisiert.
Die erste Garnitur
Über Reimanns Partitur ist schon vor der Uraufführung schriftlich und mündlich heftig polemisiert worden: Der Abend endete mit einem schier einspruchslosen Triumph für Komponisten und Mittler, Aribert Reimann bedankte sich bei allen höflichst, vor allem aber sollte er einen Kranz in Stratford niederlegen.
Nach dem Motto "Uraufgeführt zu werden ist nichts, nachgespielt zu werden ist alles" seien leise Zweifel an der Haltbarkeit des Erfolges angemeldet. Das Werk ist auf die Persönlichkeit von Dietrich Fischer-Dieskau hin komponiert und einen vollkommeneren Interpreten wird Reimann nicht finden können; man darf bei ihm ruhig an Werner Krauß denken. Die Bayerische Staatsoper hatte ja überhaupt ihre erste Garnitur in diese Schlacht für einen Zeitgenossen entsandt (Helga Dernesch, Colette Lorand, Julia Varady als herzerschütternde Cordelia, den Counter-Tenor David Knutson, Richard Holm etc.). Gerd Albrecht vollbrachte mit dem erstaunlich bereitwilligen Orchester Klangwunder, Ponelle schuf eine Modellinszenierung ... aber die Partitur ist aberwitzig schwierig, wohl nur an ersten Bühnen spielbar.
Aribert Reimann beherrscht virtuos das Musik-Esperanto unserer Zeit: Zu Clusterschichten verdichtete Streicherflächen, die auf- und absteigen, um einander kreisen, Raumklänge mit jäh einbrechenden Schlagzeugen werden bevorzugt, starr-aggressive atonale Akkordballungen, in weiten Intervallen geführte Singstimmen, wilde Blechstürze, Reihen, auf den Notenlinien, nicht mit dem Ohr erkennbar, abgerissene Tongebilde. Überbeanspruchung von Instrumentations-Verfremdungen wie mit Halb- und Vierteltönen, die in einem Klangstrudel enden – und das fast immer austauschbar.
Illustrationsmusik?
Zuweilen stellen sich nachvollziehbare Stimmungen ein: Lears Totenklage, Lears Fluch, Lears heiterer Wahnsinn... Man ertappt sich bei so ungemein anödender ermüdender Geräuschkulisse, die so wenig gliedert, so gar nichts unverwechselbar mit Gestalt und Situation schildert, in irgendeinem faßlichen Akkord, in einem Tonsymbol, in einem einsam vor sich hinwimmernden Cello, einer einsam klagenden Oboe, in einem ungemein intensiv vorgetragenen Streicher-Unisono, ja in einem vereinzelten tonalen Akkord schon "Musik" zu empfinden. Nach unzähligen Fortissimo-Attentaten, Gejammer in Vierteltönen (wohin soll das eigentlich führen, noch aufteilbarer ist die Chromatik kaum?) empfindet man selbst eine Generalpause schon als musikalische Oase. Mir war das alles zu eintönig, kaum je empfand ich eine Shakespeare-Szene "musikalisch transportiert". Die Vertonung scheint mir Illustrationsmusik, die Tragödie kommt nur dank Dietrich Fischer-Dieskau zuweilen in Deutungs-Höhen von Strehlers Sprech-Theater.
Das Vertrauen außergewöhnlicher Sängerpersönlichkeiten in Reimann gibt meiner Meinung sicher Unrecht, es handle sich hier nur um den bravourös aufgedonnerten Mißbrauch einer der gewaltigsten Tragödien des Abendlandes zur Verdeckung musikalischer Impotenz. Hoffentlich ist entgegen meiner Meinung die Opernbühne um ein Meisterwerk reicher geworden.
Klaus Adam
Zeitung und Datum unbekannt
"Lear" - ein grausiger Aufschrei
Aribert Reimann-Uraufführung bei den Münchner Opernfestspielen
Vom brutalen Klang-Inferno bis zur lyrischen Piano-Innigkeit des Schlusses wies der Komponist Aribert Reimann seinem "Lear" den dornenreichen Weg. Von Shakespeare blieb in der Texteinrichtung von Claus H. Henneberg nicht viel mehr übrig als die traurige Geschichte von zwei törichten Vätern, die nach unverständlichen Kriterien ihr Erbe an ihre bösen Kinder geben, indes sie die guten von sich stoßen und bitter dafür büßen müssen. Und diese Story hatte schon Shakespeare übernommen.
Da man zudem von Opernsängern - zumal in extremen Stimmlagen - nicht allzuviel Text versteht, mußte man sich an das grausame Handlungsgerüst halten, das der Komponist über weite Strecken mit aufwühlenden harten Klangmassen vorwärts treibt, aufgerissen von deformierten Tonschüben, bewußt vertrackten Bläser-Fehltritten, übergellt vom künstlich hochgepeitschten Sopran der beiden bösen Lear-Töchter, ein makabrer Klangteppich, der sich suggestiv im Crescendo ins Ohr bohrt und die Handlung ins leicht Irreale steigert. Die extreme Künstlichkeit der musikalischen Atmosphäre nahm der Regisseur und Bühnenbildner Jean-Pierre Ponnelle fast traumwandlerisch auf für sein kühn-stilisiertes Regiekonzept, das dieser Reimann-Oper den Weg zum Erfolg bahnte.
Erst in der letzten Hälfte des zweiten Teiles gewann der "Lear" menschlichere Züge, wurde die Klangwut aufgehalten, tropfte tiefe Trauer im leisen Orchestergewebe. Ganz zarte Tonfarben vibrierten bei Cordelias Tod. Da geriet Reimanns Komposition zur illustrativen Schauspielmusik für Shakespeares "Lear".
Ponnelle spiegelte in seiner Ausstattung die trostlos harte Klangwelt der Musik wider: Unterm nackten hohen schwarzen Bühnenhaus eine Steinwüste mit stacheligen Grasbüscheln, die sich in Teilen hochwölben konnte, um so, mit den einfachsten Mitteln, wie selbstverständlich verschieden hohe Spielebenen aufzubauen. Hier vergab der törichte Lear sein Erbe an die unmenschlichen Töchter, hier verstieß Gloster in fatalem Unverständnis seinen Sohn Edgar, hier wurde er geblendet, hier nahm sich der Wahnsinn gnädig des unglücklichen Lear an, und hier endlich kamen nahezu alle Beteiligten elendiglich um.
Der Narr verschwindet bei Shakespeare sang- und klanglos mitten im Stück. Auch hier entledigte er sich am Ende des ersten Teiles seines Mantels und der riesigen roten Narrenkrone und wurde nicht mehr gesehen. Überhaupt läßt ihn Reimann sang- und klanglos. Eine reine Sprechrolle - mal eintönig, mal gegenrhythmisch skandierend -, blieb sie in Rolf Boysens Interpretation etwas blaß.
Dafür strahlte der Stern des hochkarätigen Sängerensembles um so heller. Natürlich stand Dietrich Fischer-Dieskau im Mittelpunkt, ein Lear in dieser Version, den man bedingungslos ideal nennen kann. Der oberflächliche König, der waidwunde enttäuschte Vater, der Wahnsinnige und der große Schmerzensmann des Schlusses fanden sich in diesem großartigen Sänger und Rollengestalter auf wunderbare Weise wieder. Sein Part (und seine hervorragende Sprechkultur) erlaubte auch ein Verstehen seines Textes.
Die bösen Töchter Regan und Goneril - obgleich der Liederkomponist Reimann die Stimmen immer sorgfältig über den Orchesterklang stellte - konnten bei ihren extremen Stimmlagen kaum mit Wortverständlichkeit rechnen. Die Regan zumal hatte außerordentlich schwierige Koloraturen in hohen Eisesregionen zu bewältigen, wofür die exzeptionelle Sängerin und leidenschaftliche Schauspielerin Colette Lorand gerade die richtige war. Die Goneril der Helga Dernesch durfte sich in normaleren Sopran-Kurven bewegen, wenn ihre Bösartigkeit natürlich auch in schrillen Farben flackerte. Julia Varady sang die sanfte Cordelia wunderschön. Sie erschien als der reine, ruhige Pol in diesem großen grausigen Aufschrei.
Ein Kuriosum im Ensemble war der Counter-Tenor David Knutson als Edgar. Diese Männerstimme zwischen Sopran und Tenor, wechselnd von Kopf- zu Bruststimme, brachte zusätzlich ein eigenartiges künstliches Element in die monströse Klangwelt Reimanns. Es gibt nur eine Handvoll Sänger dieses Fachs. Der in Berlin engagierte Amerikaner David Knutson ist ein Glücksfall, auch was seine schwierige Gestaltung des sich wahnsinnig stellenden jungen Gloster-Sohnes betrifft. Den alten Gloster, Schicksalsgenosse Lears, sang Hans Günter Nöcker.
Die leitende musikalische Hand dieses extrem schwierigen Opernabends führte Gerde Albrecht, derzeit Chef des Zürcher Tonhalle-Orchesters, dem für das überdimensionale Partitur-Buch eigens ein neuer Tisch gebaut werden mußte. Er war ein geradezu besessener Interpret am Pult; das Bayerische Staatsorchester riß er in eine Hochform, die vom Publikum jubelnd bewundert wurde.
Mit Albrecht, Ponnelle und dem Sängerensemble gelang Aribert Reimann der große Sieg in München. Es regnete Rosen und Beifall. Die paar Buh-Rufer bei Reimanns Erscheinen waren kaum wahrzunehmen.
H. Lehmann